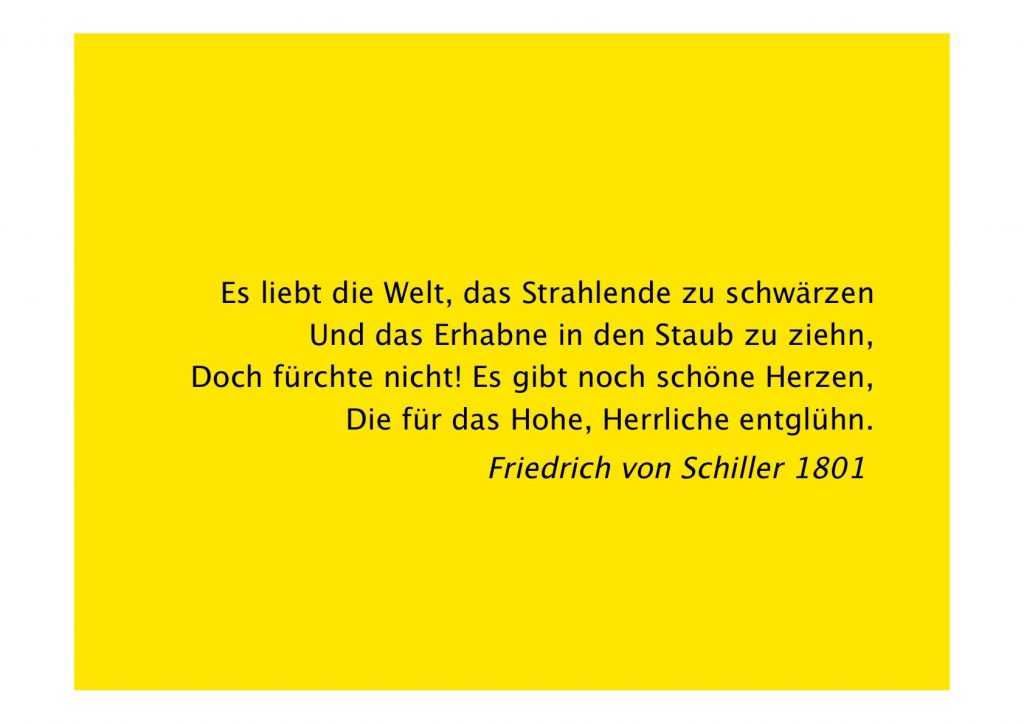
Daß wir zwei Tage in Folge auf Friedrich von Schiller zurückgreifen, ist eher Zufall. Unser heutiges Zitat soll illustrieren, daß Vorfälle wie der folgende durchaus nicht neu sind – wenn auch die Häufigkeit besorgniserregend zunimmt. Was ist passiert? Yoshiro Mori, der Chef des Organisationskomitees der Olympischen Sommerspiele, die demnächst mit einem Jahr Verspätung in Tokyo stattfinden sollen, wurde gefeuert. Natürlich nicht wirklich gefeuert, of course. Japaner sind höflich – und so hat man sich auf einen „Rücktritt“ verständigt. Hintergrund: Ein einziger Satz. Yoshiro Mori hatte am Rande angemerkt, daß Sitzungen mit hoher Frauenbeteiligung sich oft unangenehm in die Länge zögen. Warum? Weil Frauen nun mal einen zeitaufwendigeren Kommunikationsstil pflegten. Man könnte auch sagen: Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wörterbuch. Skandal! Voll die sexistische Entgleisung!
Kann man das so sehen? Natürlich. Muß man das so sehen? Natürlich nicht. Bolle meint: Entweder war das eine schlichte Meinungsäußerung. Dann ist sie durch Art. 5 I GG (bzw. das japanische Äquivalent dazu) gedeckt – falls wir die Angelegenheit überhaupt so hoch hängen wollen. Oder es war eine Tatsachenbehauptung. In diesem Falle wäre es einer Überprüfung zugänglich. Wozu gibt es Sitzungsprotokolle? Falls man sich geirrt haben sollte, nimmt man die Behauptung eben mit einem Ausdruck des Bedauerns zurück – und gut isset.
Aber so? Aufschrei der Straße – wobei sich die Straße 2.0 praktischerweise in den sozialen Medien befindet, man also nicht mal vor die Tür gehen muß, um sich gründlich zu empören. Demos 2.0 nennt Bolle das. Darauf folgt blitzeschnelle die massenmediale Verstärkung des Aufschreies. Skandal, Skandal! Dazu kommt regelmäßig immer gleich die Verhängung der Höchststrafe. Zwar hat niemand gefordert, daß Yoshiro Mori Harakiri (bzw. Seppuku) begehen soll – wir leben schließlich in vergleichsweise zivilisierten Zeiten. Aber die umstandslose Entfernung aus Amt und Würden ist heute eben die Höchststrafe 2.0.
Demokratische Legitimation des Demos 2.0? Fehlanzeige. Rechtsstaatliche Verhältnismäßigkeitsprüfung? Fehlanzeige. Abwägung Problemlösung (die Spiele wollen organisiert sein) vs. Pflege der Befindlichkeiten (Mimimi)? Fehlanzeige. Schon Aristoteles (384–322 v. Chr.) war übrigens klar, daß man es mit der Demokratie – sehr zum Schaden des Gemeinwesens, übrigens – durchaus auch übertreiben kann, und hat dabei ausdrücklich zwischen Politeia und Demokratie als zwei polaren Ausprägungen der Herrschaft der Vielen unterschieden. Aber das ist ja erst zweieinhalb tausend Jahre her – und wäre im übrigen auch schon wieder ein anderes Kapitel.
