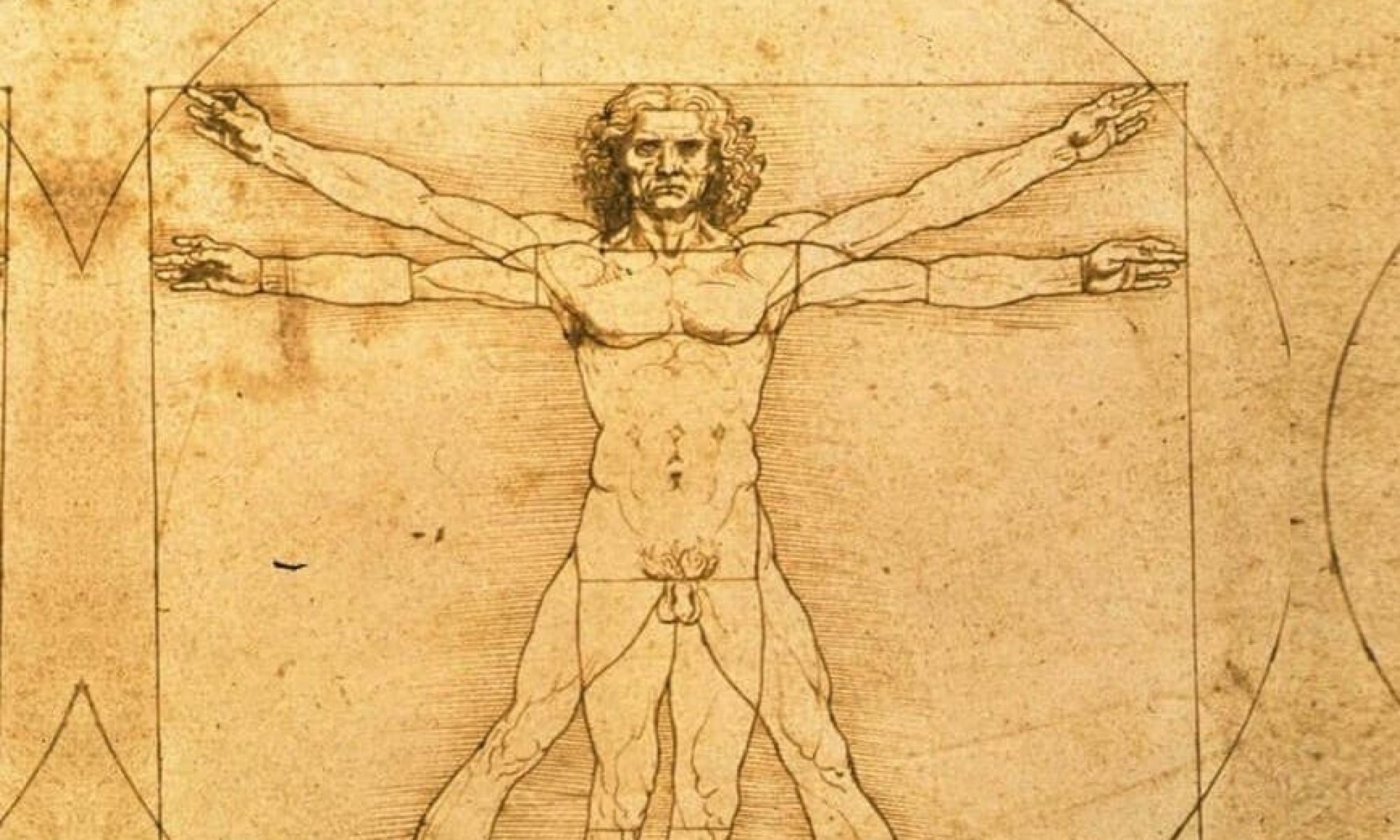Oft sind es ja die kleinen Dinge, die, je nach Tagesform, erheitern oder auch befremden. So ist Bolle eine Meldung untergekommen, der zufolge gut ein Fünftel der Doktoranden (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) aus 2012 mit ihrer Doktorarbeit noch nicht fertig sind.
Bolle meint: Na und? Gut 8 Jahre, das ist ein Wimpernschlag vor dem Herrn. Zwar sollte man, wenn alles nach Plan läuft, nicht länger als 3 Jahre brauchen. Entsprechend sehen die Ergebnisse dann ja auch aus. Doch Vorsicht! Auch bei Doktorarbeiten handelt es sich um ein Teekesselchen der tückischen Sorte – mit hoher Konfusionsgefahr. Namentlich sind zeitgesteuerte strikt von ergebnisgesteuerten Arbeiten zu unterscheiden. Dabei ist eine zeitgesteuerte Arbeit fertig, wenn die Zeit um ist, und der Doktorand etwas vorlegt, das man mit etwas gutem Willen als Abschlußarbeit durchgehen lassen kann. Glückwunsch! Bei einer ergebnisgesteuerten Arbeit liegen die Dinge anders. Hier weiß kein Mensch, wie lange es dauern wird, bis sich die schiere Fülle der Phänomene in eine gefällige Form wird fügen lassen. Der letzte, der das wissen kann, ist der Doktorand. Er ist nun mal kein Holzfäller, der überschlagsmäßig überblicken kann, wieviel Morgen Wald noch vor ihm liegen.
Aber darum geht es auch immer weniger. In einer Welt, die Planbarkeit über alles liebt, müßte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man nach den vorgesehenen 3 Jahren nicht fröhlich „Fertig!“ krähen könnte, ohne allzu rot zu werden. Mehr wird ja auch gar nicht erwartet. Hauptsache, der Zeitplan stimmt. Und wenn nicht, dann dauert es halt weitere 3 Jahre. Und noch weitere 3 Jahre – und schon findet man sich unter den zielverfehlten Langzeit-Doktoranden wieder. Glücklicherweise ist es dabei aber meistens so, daß man einfach nur den Schuß nicht gehört hat und die Doktorarbeit so eine Art touch down erfahren hat. Sie gammelt in irgendeiner hinteren Schublade unvollendet vor sich hin, derweil der Doktorand am sausenden Webstuhl der Zeit anderweitig zu tun hat – dabei auf Nachfrage aber gerne weiterhin verkündet, daß er „promoviere“.
Im Grunde schließt sich hier der Kreis des Elends. Bolle findet ja, daß »promovieren« von lat. promovere kommt und ›vorwärts bewegen‹ oder auch ›befördern‹ bedeutet. Natürlich kann man sich, strikt reflexiv, selber vorwärtsbewegen. Oft genug ist das auch nicht das schlechteste – hier aber nicht gemeint. Man stelle sich einen schlichten Angestellten vor, der verkündet, daß er „befördere“. Die Frage „Ja, und was?“ wird nicht lange auf sich warten lassen. Wenn er nun nachsetzt und verkündet: „Na, mich selbst“, dann muß er mit der Frage rechnen: „Und? Wohin?“ – „Na, auf die nächste Stufe der Leiter, halt.“ – „Du? Dich? Selber?“ – So geht das also nicht. Befördert wird man – passiv und nicht reflexiv. Für „promoviert“ gilt selbiges.
Wenn das alles etwas klarer wäre, dann hätten wir es vermutlich auch weniger mit den ganzen Karriere-Doctores zu tun, die frei nach Mephistopheles’ Motto verfahren: „Ein Titel muß sie erst vertraulich machen, // Daß meine Kunst viel Künste übersteigt …“. Mit Wissenschaft im engeren Sinne hat das indes nicht mehr allzu viel zu tun.
Fassen wir es so: Giovanni Trapattonis „Ich habe fertig“ läßt, was Sprachgewalt und Wortgewandtheit angeht, ein albernes „Ich habe promoviert“ weit hinter sich. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.