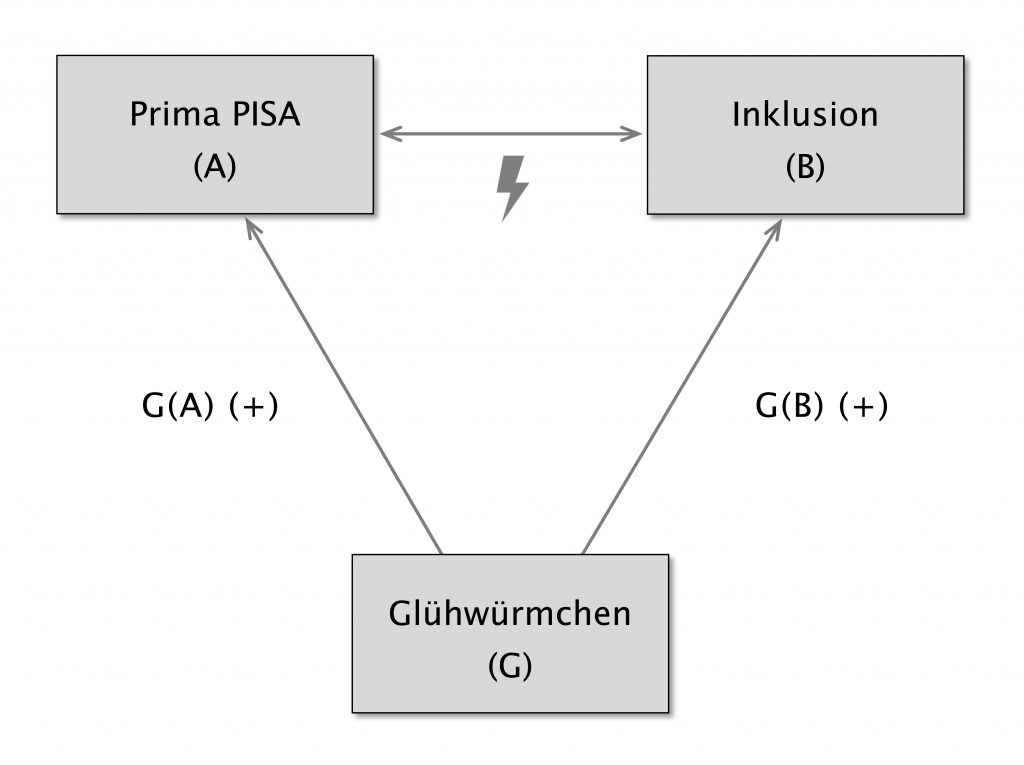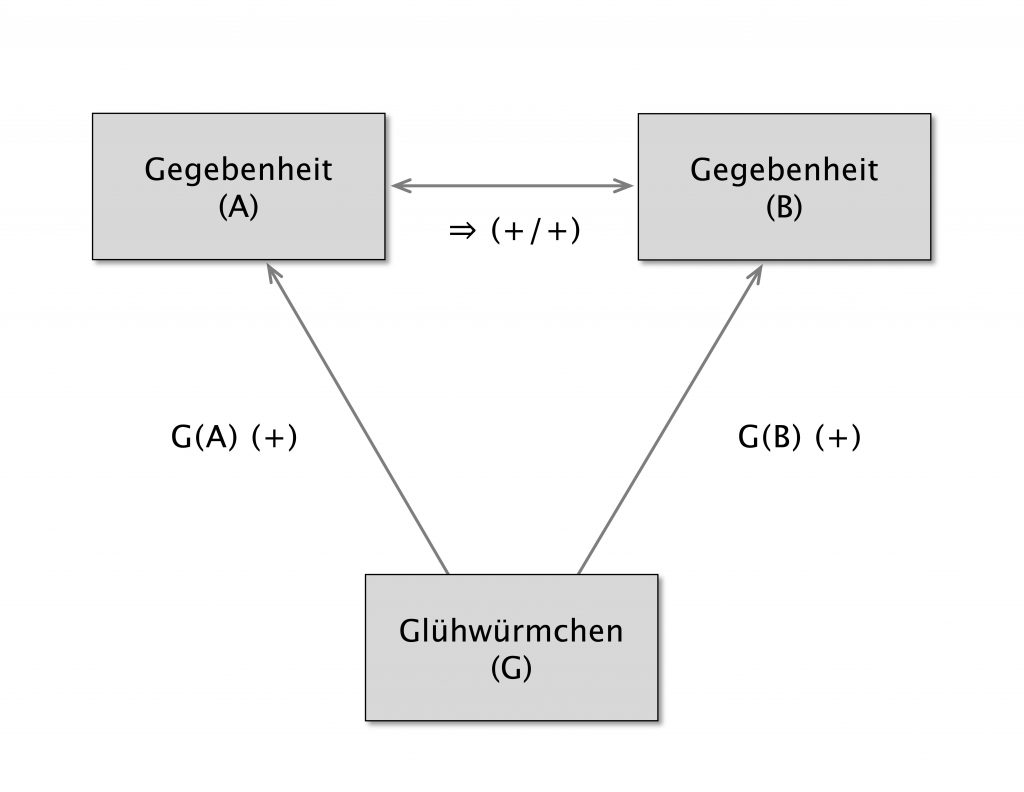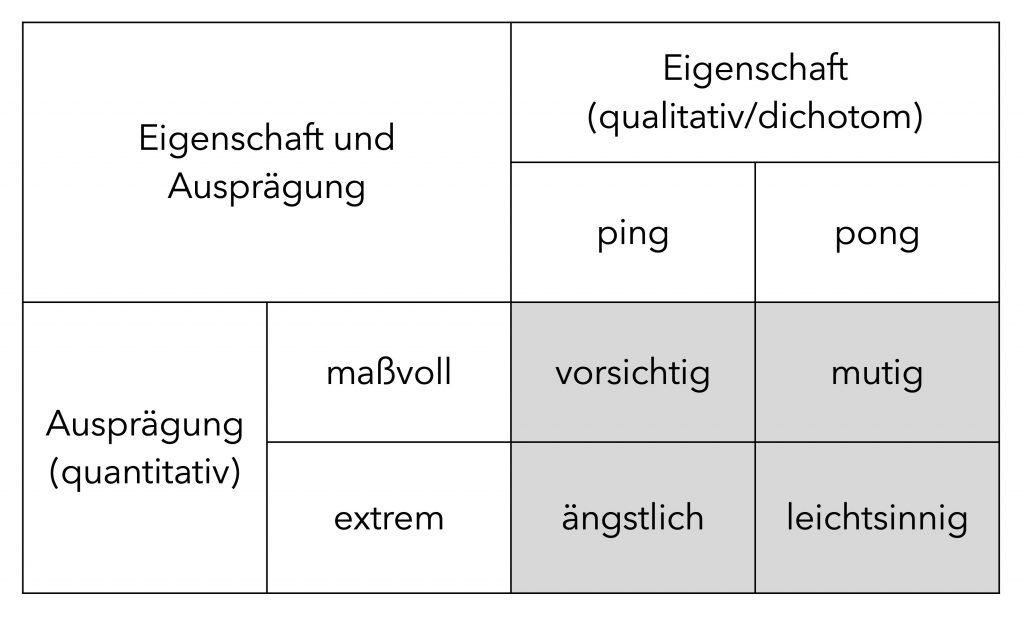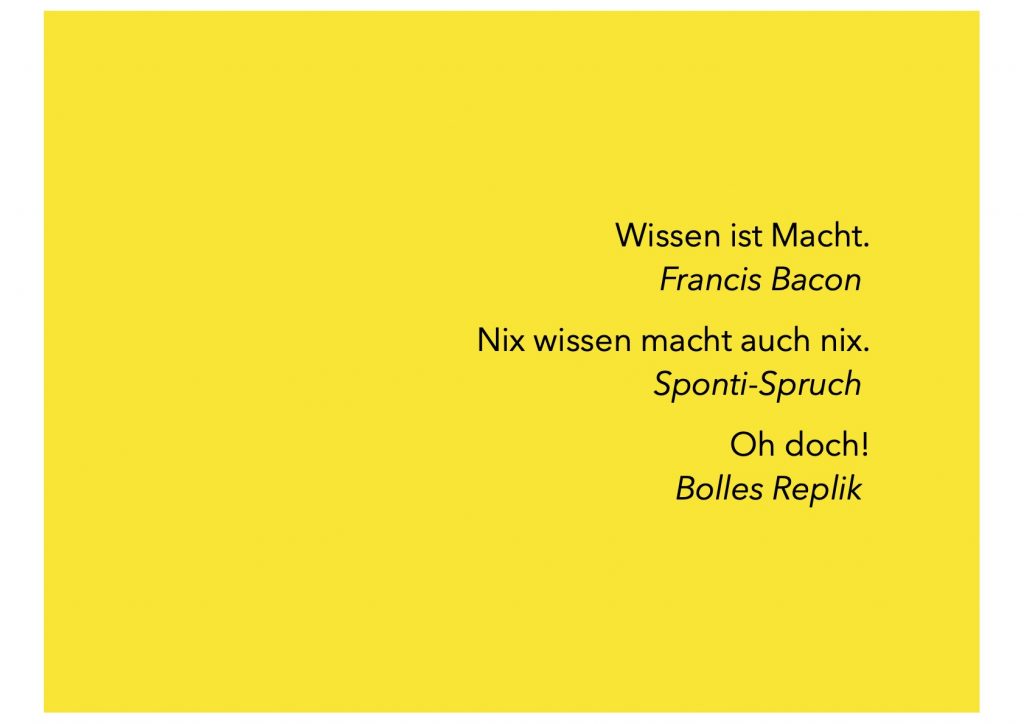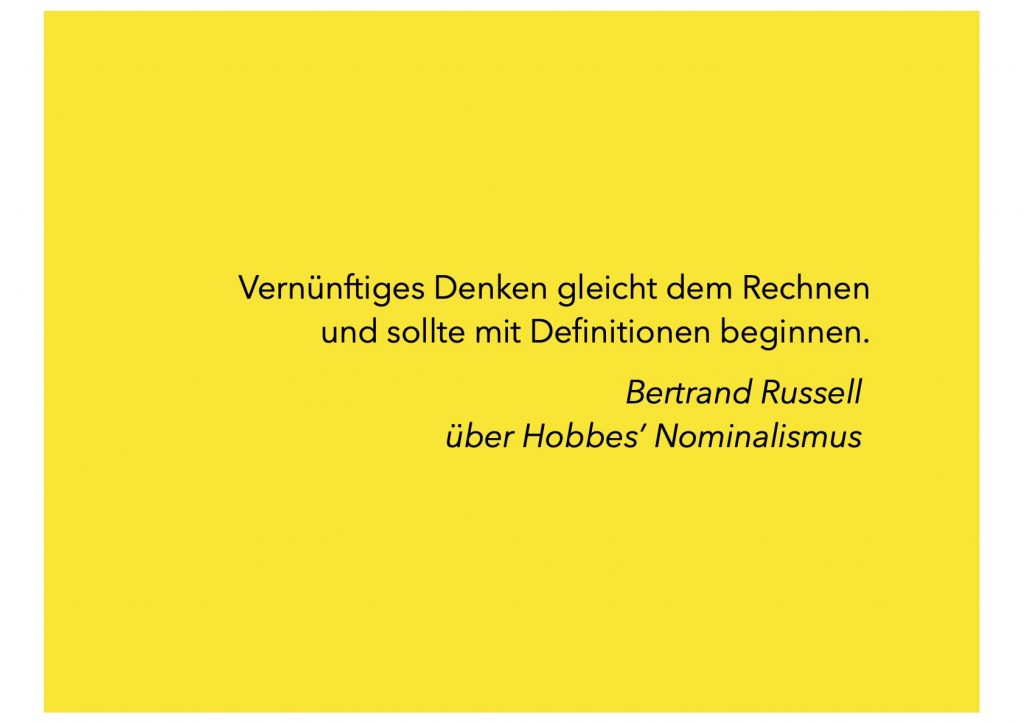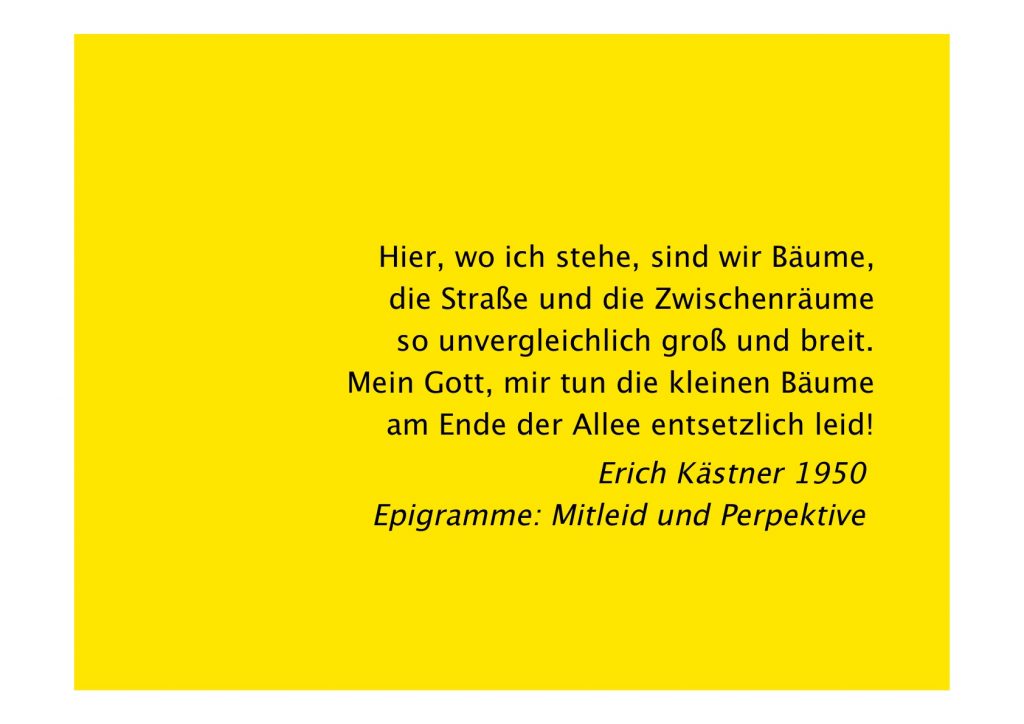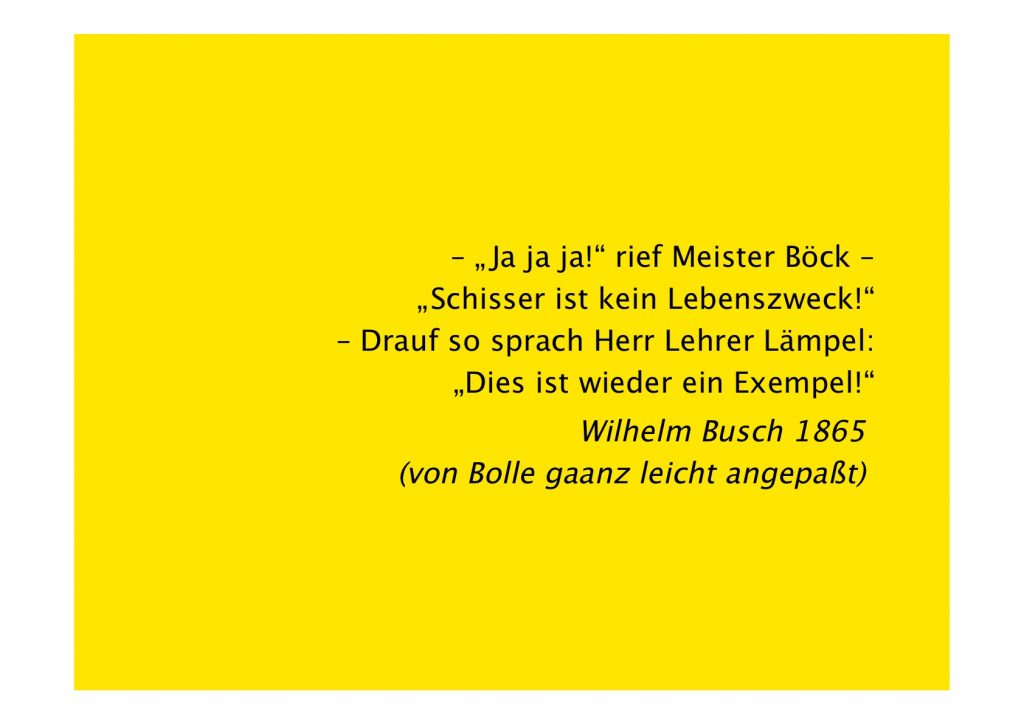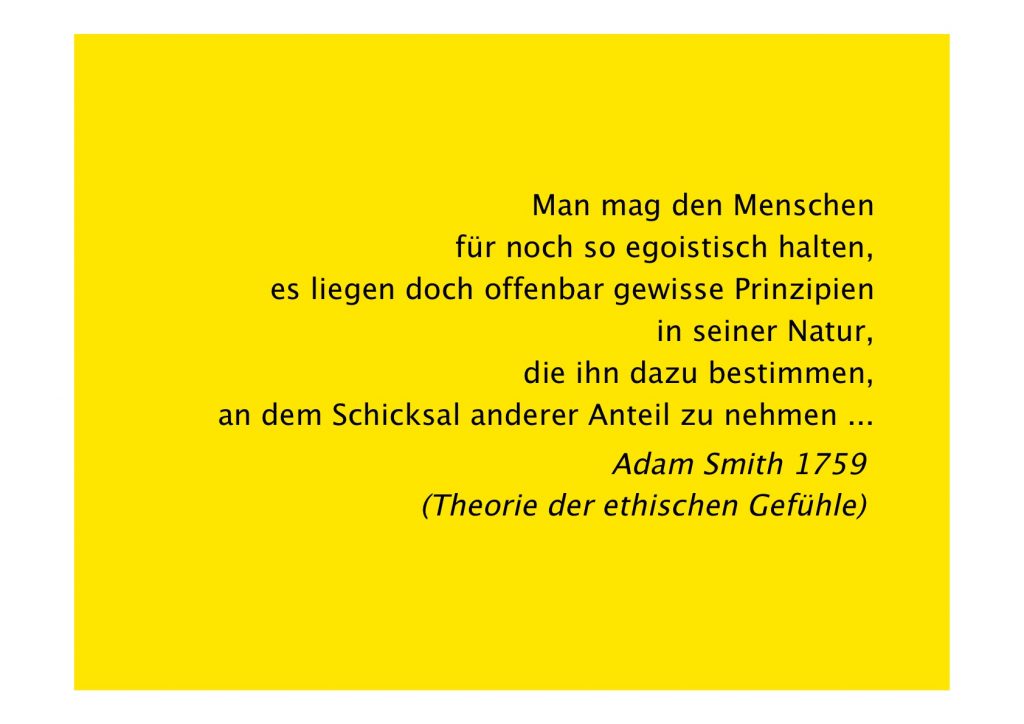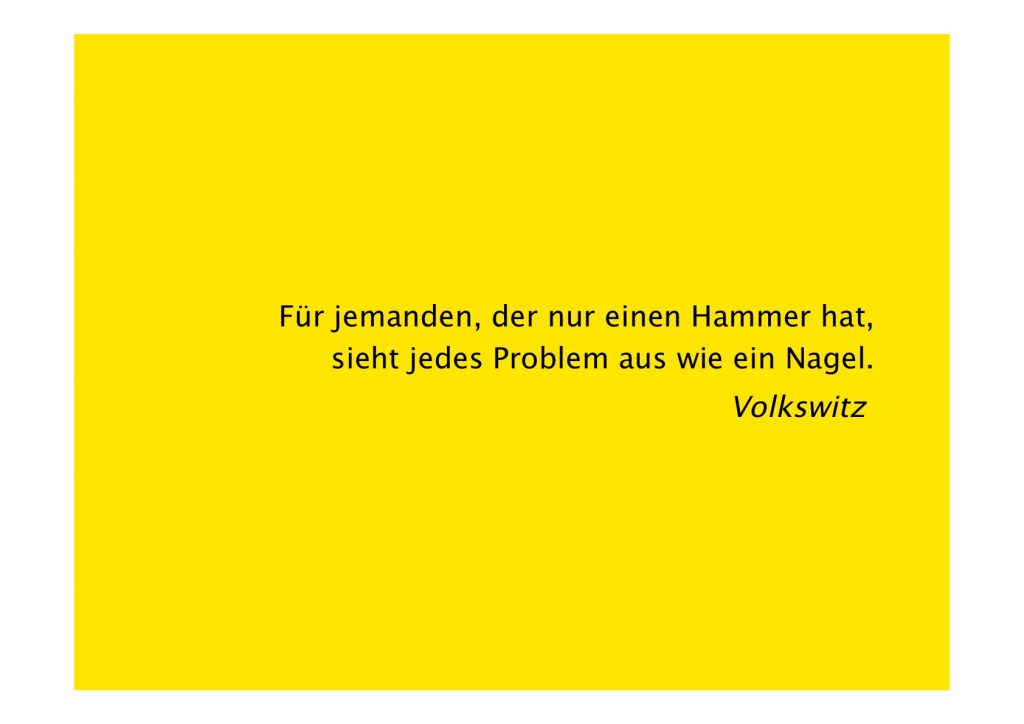Um unsere Europa-Wahlen langsam, aber sicher ausklingen zu lassen, hier ein vorläufig letzter Schweif ins Thema. Diese Woche untertitelte eine Qualitätszeitung: Die Deutschen haben kaum noch Vertrauen in die Ampelregierung. Das „kaum“ übrigens hält Bolle für einen regelrechten Euphemismus. Doch das nur am Rande. Interessanter ist das Vertrauen an sich.
Technisch gesehen handelt es sich bei ›Vertrauen‹ um ein Element aus Welt III (vgl. dazu So 26-05-24 Das bessere Argument): Mangels besserer Möglichkeiten modelliert man sich ein Bild – in diesem Falle von der Regierung. Ob das halbwegs stimmt? Wer weiß. Allein das Bedürfnis nach Orientierung als Motiv jedweder Modellierung können wir sicher unterstellen. Schließlich handelt es sich dabei um eines der kognitiven Grundbedürfnisse. Auch können wir davon ausgehen, daß ein einmal modelliertes Bild zur Selbststabilisierung neigt: Informationen, die nicht ins Bild passen, werden entweder gar nicht erst wahrgenommen – oder weltbildstützend gedeutet bzw. umgedeutet.
Eine tatsächliche Weltbild-Änderung dagegen braucht entsprechend Zeit. Zumindest geschieht sie nicht über Nacht: Das Wahlvolk ist träge. Bolle fühlt sich hier an ein Bonmot erinnert, das verschiedensten Autoren zugeschrieben wird. Vermutlich handelt es sich dabei einfach nur um eine schlichte Volksweisheit:
Man kann alle Leute für einige Zeit, und einige Leute für alle Zeit an der Nase herumführen – aber nicht alle Leute für alle Zeit.
Unsere Qualitätszeitung jedenfalls fragt: Wer also stellt das Vertrauen in das System wieder her, dem die Deutschen Freiheit, Demokratie und Wohlstand verdanken?
Dahinter steckt zunächst einmal die Grundannahme, daß „das System“ im Kern ja wohl gut ist – und schon von daher bewahrenswert. Zweitens, und zwar versteckter, steckt dahinter die Idee, daß man so etwas wie ›Vertrauen‹ einfach nur „wiederherstellen“ muß – und schon wird alles wieder gut.
Bolle vermutet allerdings eher eine veritable Schaffenskrise. Schaffenskrise statt Vertrauenskrise. Das Problem wäre demnach weniger, daß dem Volke (empfängerseitig) sein Vertrauen flöten geht. Das Problem wäre eher, daß der Regierung (senderseitig) nicht genug einfällt, um das Volk von sich und ihren Vorhaben zu überzeugen.
Zugegeben: Die Idee, man müsse dem Volk das eigene Tun nur gut genug erklären, und alles würde gut, hat sich in gewissen Kreisen ziemlich breitgemacht. Angefangen hat das wohl 2015 mit Merkels seinerzeit frisch eingerichtetem „Nudging“-Team. Dabei ist Nudging – wörtlich anstupsen – nur ein freundlicher klingendes Wort für regierungsseitig angestoßene gezielte Manipulation. Erklärtes Ziel dabei ist natürlich, das Glück der Bürger zu steigern, of course. Bolle meint gleichwohl: Thanks, I’m fine.
In der Lutherbibel 1912 heißt es übrigens wörtlich: Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein (Matth. 20, 16). Allerdings nicht ohne hinzuzufügen: Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Daß sich so mancher (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) zu hohen und höchsten Taten zumindest berufen fühlt, liest man täglich in der Zeitung. Ob dieses Gefühl, in welcher Weise auf immer, allerdings auch nur halbwegs hinreichend substantuiert ist, wird man schwer bezweifeln dürfen. Beim gegenwärtigen Zustand des Journalismus 2.0 muß man dazu allerdings schon schwer zwischen den Zeilen lesen – oder andere Quellen hinzuziehen. Darf man das denn? Aber Ja doch. Immerhin heißt es in Art. 5 I GG, daß jedermann das Recht habe, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Bolle sieht da allerdings noch mächtig Spielraum, was das „allgemein zugänglich“ angeht. Schließlich arbeitet man schon seit einiger Zeit – nicht zuletzt auf EU-Ebene – mit Fleiß daran, die Grenzen des Säglichen in einem als demokratie-kompatibel erachteten Rahmen zu halten – Verfassung hin oder her. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.