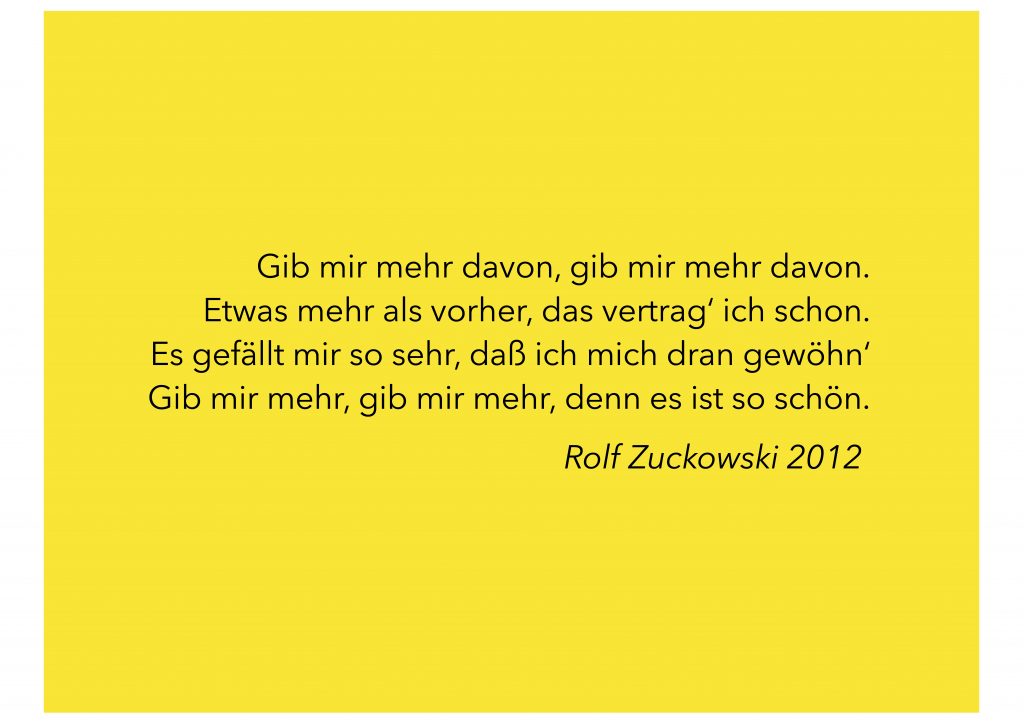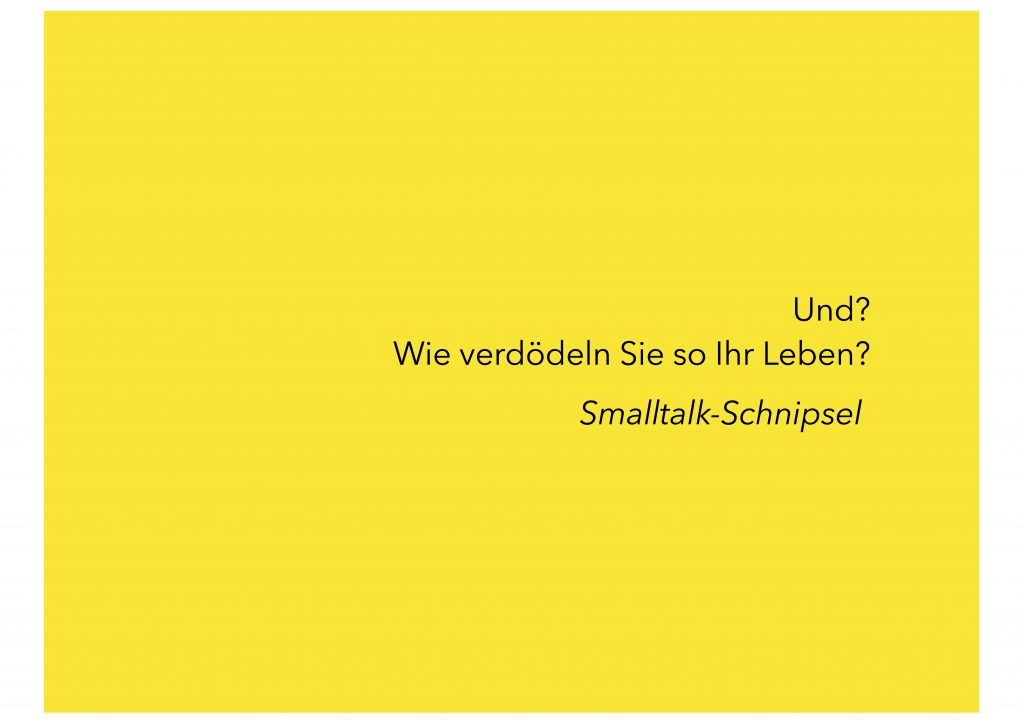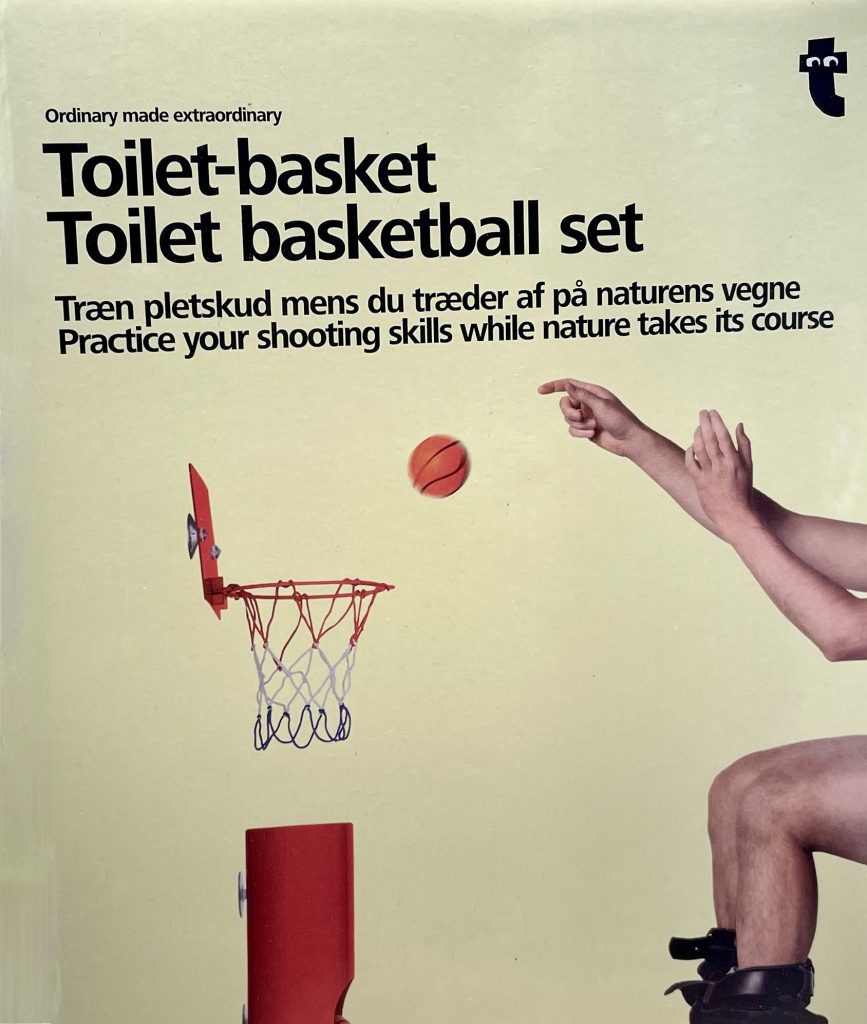Neulich saß Bolle zu ganz unbürgerlich später Stunde unter dem Fernsehturm am Alexanderplatz. Panoramablick aus der Froschperspektive, kam es ihm in den Sinn. Zwar konnte er sich lebhaft vorstellen, wie fern man sehen kann vom Fernsehturm. Allein er saß ja schließlich nur bei Fuße. Buch und Bier hatten sich in jener Nacht in einem Gläschen Dornfelder trocken und Ralf Ludwigs ›Sternstunden der Religion‹ materialisiert.
Bolle glaubt ja grundsätzlich erst mal gar nichts – eine Haltung, die, wie er findet, einem Agnostiker nicht schlecht zu Gesichte steht. Gleichwohl: man wird und soll sich ja dürfen anregen lassen. Und so hieß es im Abschnitt über Gautama, der Buddha habe die Idee eines absoluten Seins zurückgewiesen – aber auch die Idee eines absoluten Nicht-Seins. Es sei das Werden, das die Welt ausmache.
Kurzum: die Welt ist ein Werden. Das kam Bolle sehr entgegen. Hält er doch jedwede Vorstellung von Absolutem, in welcher Form auch immer, für, gelinde gesagt, kognitiv unterbelichtet. Bolle glaubt ja nicht einmal an etwas so Vertrautes wie eine absolute Masse. Vgl. dazu So 30-06-24 Die Wirklichkeit, die Wirklichkeit trägt wirklich ein Forellenkleid).
Während also Descartes 1641 schon die Tatsache, daß er denkt, für einen unumstößlichen Beweis seiner Existenz hielt – cogito ergo sum (ich denke, also bin ich) –, meint Bolle, daß die Tatsache, ein Teil des Werdens dieser Welt zu sein, ein noch viel unumstößlicherer Beweis der eigenen Existenz sein sollte: accido ergo sum (ich komme darin vor – also bin ich).
Wenn aber Sein oder Nicht-Sein allein eine Frage der Perspektive ist, dann müssen und dürfen wir uns deutlich weniger Sorgen machen: Was einmal ist, bleibt Teil des Werdens – heute und für immerdar. Es kommt halt nichts weg in diesem Universum. Selbst das, was nicht ist, kann noch werden – wie der Volksmund scherzhaft weiß.
Warum dann die ganze Spannung? Weil es das Leben so spannend macht? Wohl kaum. Bolle glaubt eher, daß wir es hier mit einer regelrechten conditio universalis zu tun haben – einer Gegebenheit des Daseins an sich. Leben heißt Leiden – wie Buddha das schon in der allerersten seiner edlen vier Wahrheiten ausdrückt.
Wenn die Herdplatte zu heiß ist, zucken die meisten zurück. Wenn der Magen zu leer ist, stellt sich regelmäßig schlechte Laune ein. Das aber ist allein eine Frage der Homöostase. Physiologisch zeigt sich das darin, daß Lebewesen bestrebt sind, unerwünschte Wahrnehmungen zu vermeiden. Affektiv zeigt es sich darin, erfreuliche Dinge anzustreben und unerfreuliche möglichst zu meiden. Kognitiv schließlich zeigt es sich in einem Streben nach Ertrag und der Vermeidung von Aufwand – wie selbst Ökonomen wissen. Wer mag, mag sich unter diesem Aspekt noch einmal das Drei-Welten-Modell anschauen (vgl. So 07-07-24 Böse Buben). Wir reden hier von Welt II, der Welt der Wahrnehmung und Bewertung – also der spontanen und unmittelbaren Einordnung jedweder Wahrnehmung in erwünscht, W(+), bzw. unerwünscht, W(–).
Daraus erklären sich ohne weiteres auch die Versuche der verschiedensten Religionen bzw. philosophischen Richtungen bis hin zur Stoa, dem Leiden ein Schnippchen zu schlagen, indem man es einfach ignoriert.
Die gute Nachricht: Mit Sein oder Werden hat das alles wenig zu tun. Auch wer das Leiden nicht überwindet – wer von hinnen scheidet gar – ist unverbrüchlicher Teil des Werdens dieser Welt, und als solcher unkaputtbar, immerdar. Oder, um das Motto der Olympischen Spiele zu zitieren: Dabei sein – bzw. dabeigewesen zu sein – ist alles. Das stimmt zwar nicht ganz – ist an dieser Stelle aber bestmöglich tröstlich. Also entspannt Euch. Oder, um im Bilde zu bleiben: Wird schon … Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.