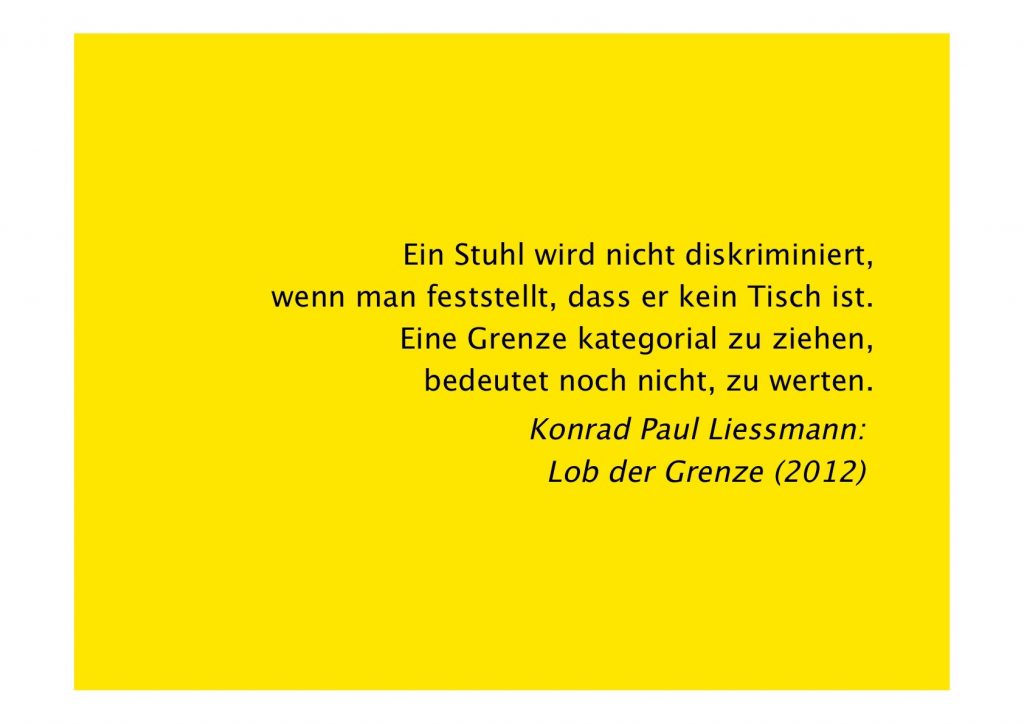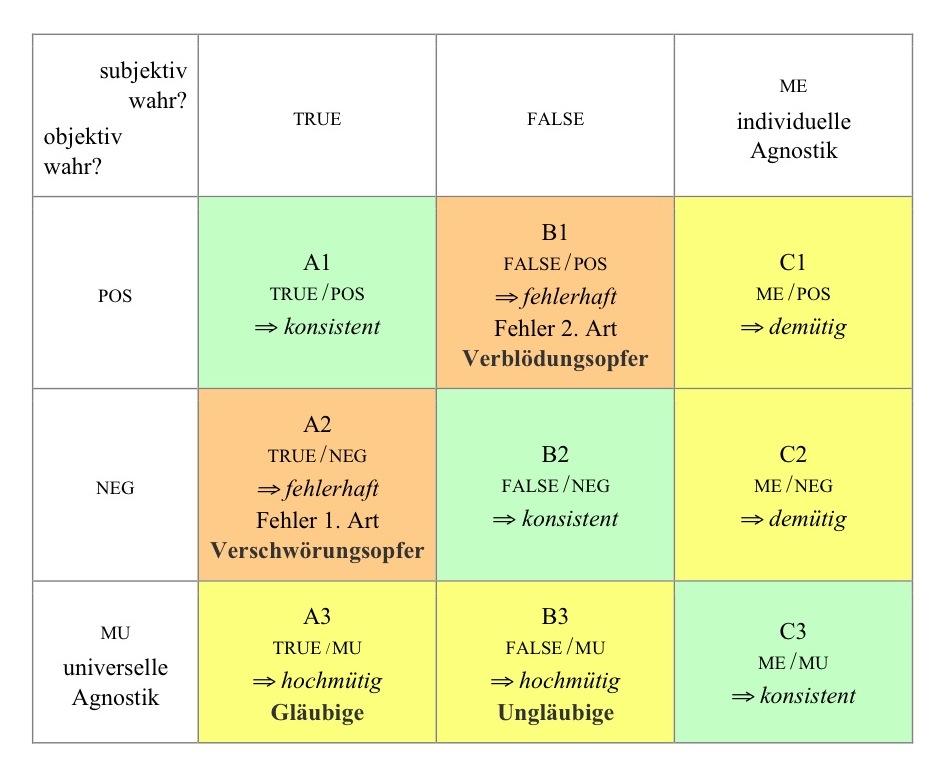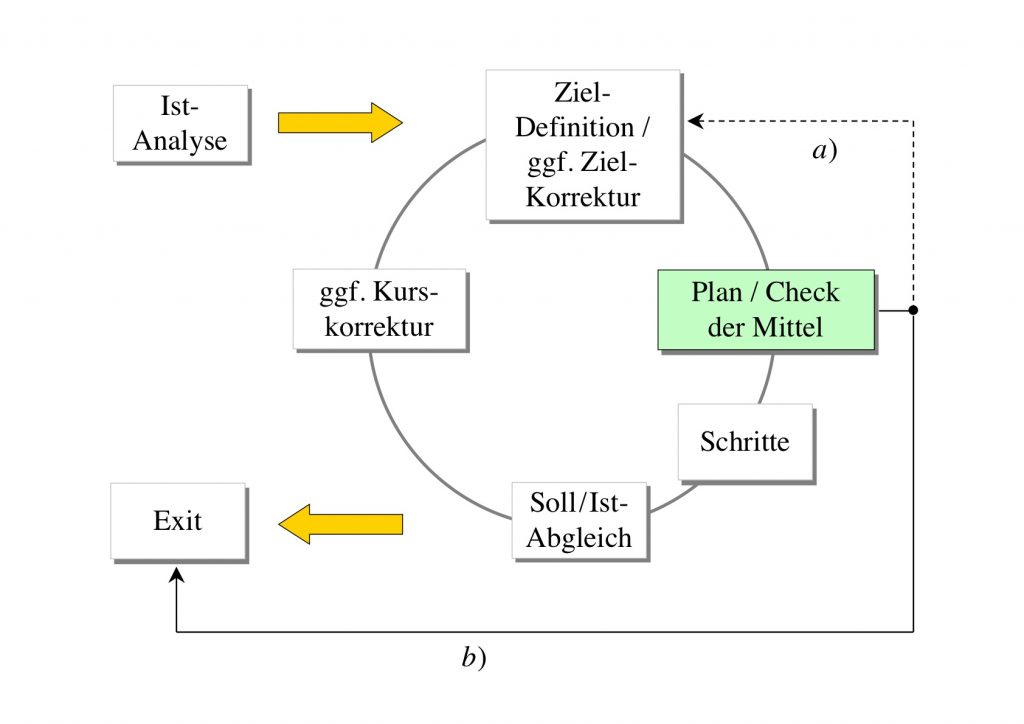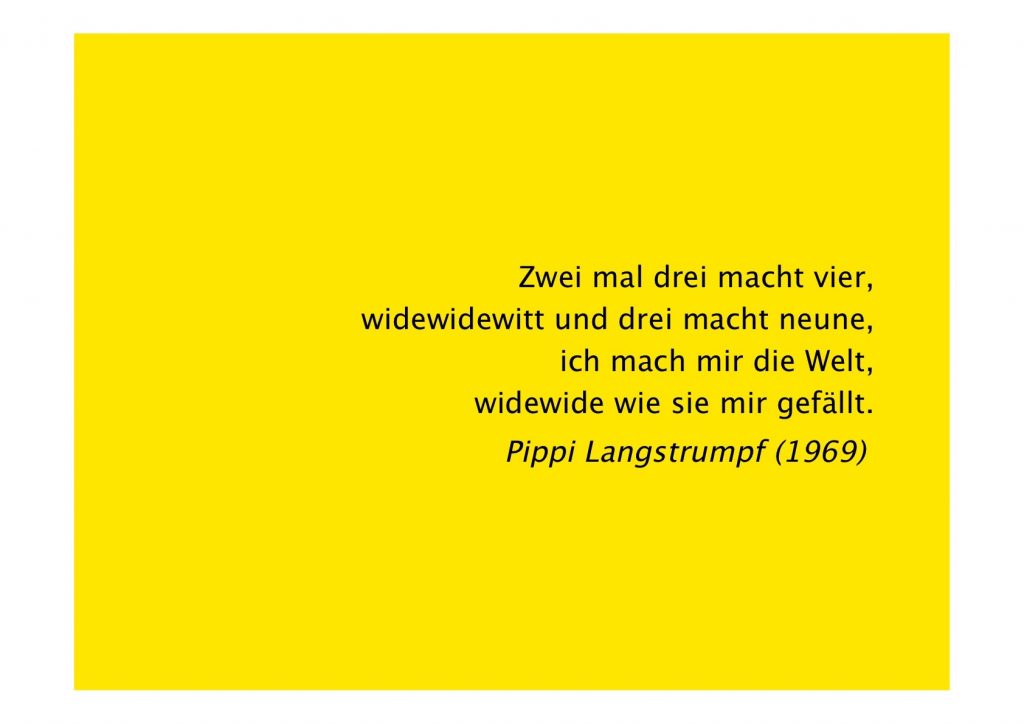
Seinerzeit schon, vor über 50 Jahren, hatte sich Pippi Langstrumpf im Namen der Ideosynkrasie souverän nicht nur über die Mathematik bzw. Arithmetik an sich, sondern sogar über deren Axiomatik hinweggesetzt. Damals war das noch spaßig und erfrischend. Allerdings dürfte kaum ein Schüler (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) auf die Idee gekommen sein, das bei Pippi Langstrumpf gelernte im Rechenunterricht praktisch anzuwenden. Heute, 50 Jahre später, wird aus Spaß langsam Ernst. Wenn man den aktuellen Meldungen Glauben schenken darf, dann keimt in den USA, dem Land of the Free, allen Ernstes eine Debatte auf, die Pippi Langstrumpf locker in den Schatten stellt. Damit aber hätte der Ideosynkrasie-Virus eine Artengrenze übersprungen – vom Sozialen zum Formalen. Aber der Reihe nach.
Hier zunächst ein Beispiel für das Soziale: Wolfgang Thierse, der ehemalige Bundestagspräsident und SPD-Urgestein, hat neulich in einem Gastbeitrag in der FAZ beklagt, daß Debatten über Rassismus, Postkolonialismus und auch Gender-Sprech immer aggressiver geführt würden, und sich dabei über Cancel Culture eher kritisch geäußert. Auch sei Blackfacing nicht weiter bedenklich. Prompt zeigte man sich in der SPD-Spitze „beschämt“ über ein solch „rückwärtsgewandtes“ Bild, das so nicht länger zur Partei passen würde. Bolle meint: Woher wissen die eigentlich immer so genau, wo vorwärts und wo rückwärts ist? Und aus welcher Quelle speist sich eigentlich das Schamgefühl?
Hier nun das Formale. Anscheinend wird in den USA neuerdings ernstlich darüber debattiert, ob die Idee, daß 2 + 2 = 4 sei, nicht doch eher kulturelle Gründe habe, und nicht letztlich eine Folge von westlichem Imperialismus sei bzw. der Kolonisierung der Welt.
Dabei scheint sich die Virulenz bereits in einem fortgeschrittenem Stadium zu befinden: So heißt es in einem Rundbrief des Kultusministeriums (!) in Oregon, die Forderung an Mathematik-Schüler, in ihren Klausuren nur ein einziges, überdies auch noch möglichst zutreffendes Ergebnis vorzulegen, sei ein Zeichen „weißer Vorherrschaft“. Recht so, meint Bolle. Nieder mit den alten, weißen Männern und ihrer rassistischen Arithmetik – von Mathematik zu reden wäre hier wohl schwer übertrieben.
Bolle fragt sich ernstlich, ob er nicht vielleicht übertrieben stumpf ist bzw. zu wenig aufgeschlossen für neue Wege der Mathematik. Auch ist ihm klar, daß man eine Mathematik auch auf anderen Axiomensystemen aufbauen könnte. Weiterhin ist ihm allerdings auch klar, daß kein einziges dieser Axiomensysteme dazu führen würde, daß für ein und dieselbe Aufgabe mehrere „korrekte“ Lösungen möglich sind. Mehrere Lösungswege wohl – das aber ist hier offenkundig nicht gemeint. Und so kommt er nicht umhin, sich in Anspielung an einen running gag bestimmter Karnevalssessionen zu fragen, wer diese Leute reingelassen haben mag in die Uni oder ins Kultusministerium – und überdies ein Hygienekonzept zu fordern. Das aber ist vielleicht dann doch schon wieder ein anderes Kapitel.