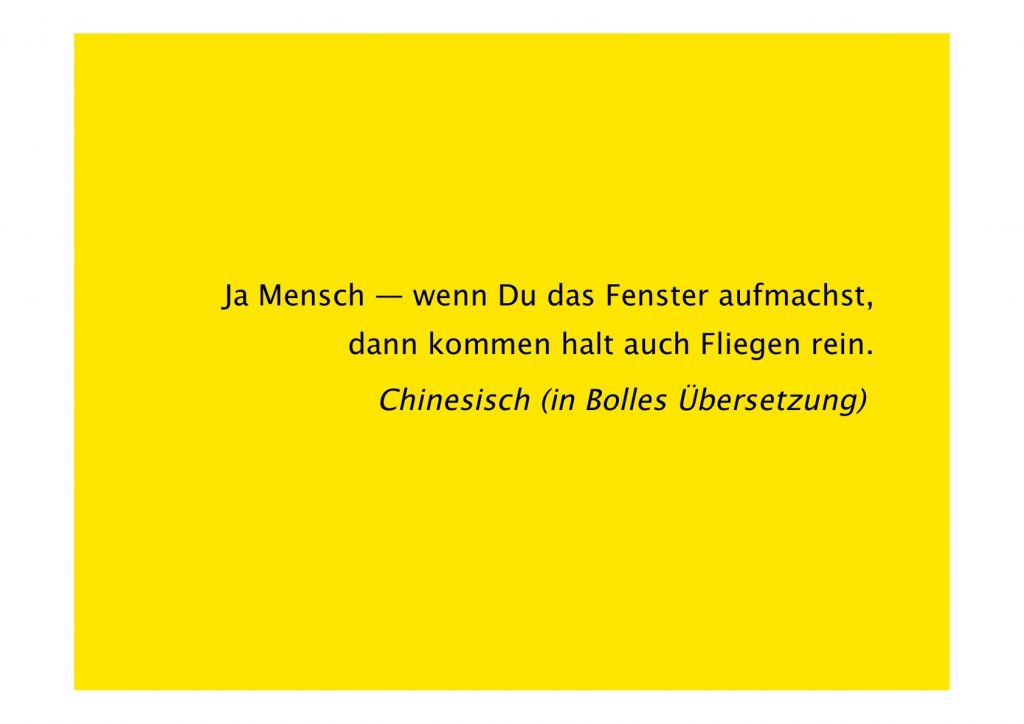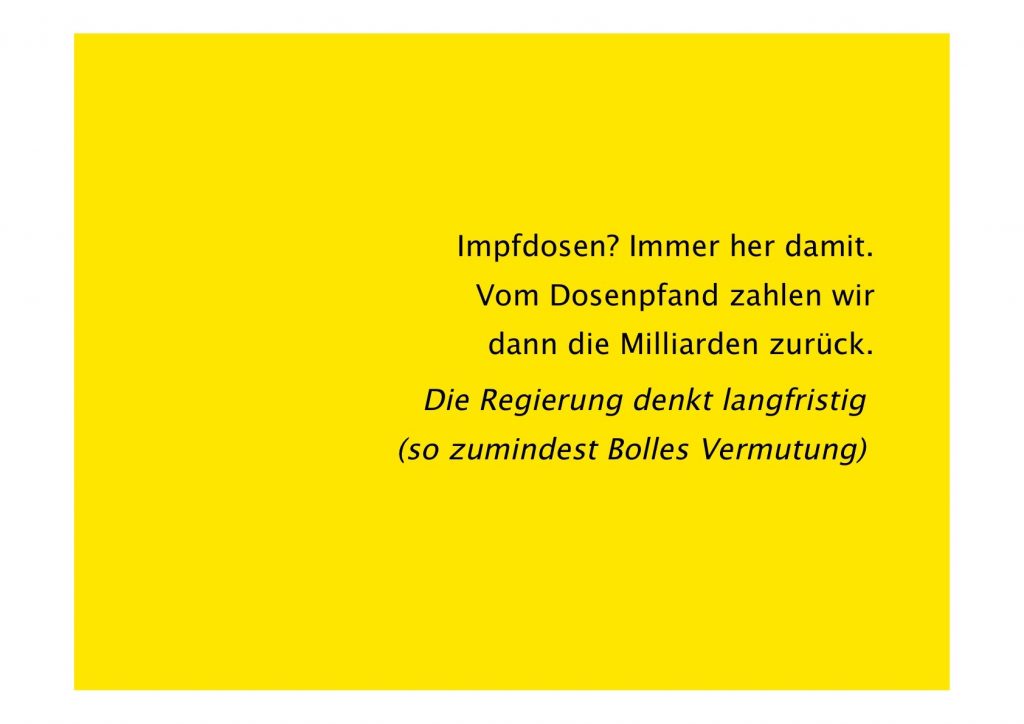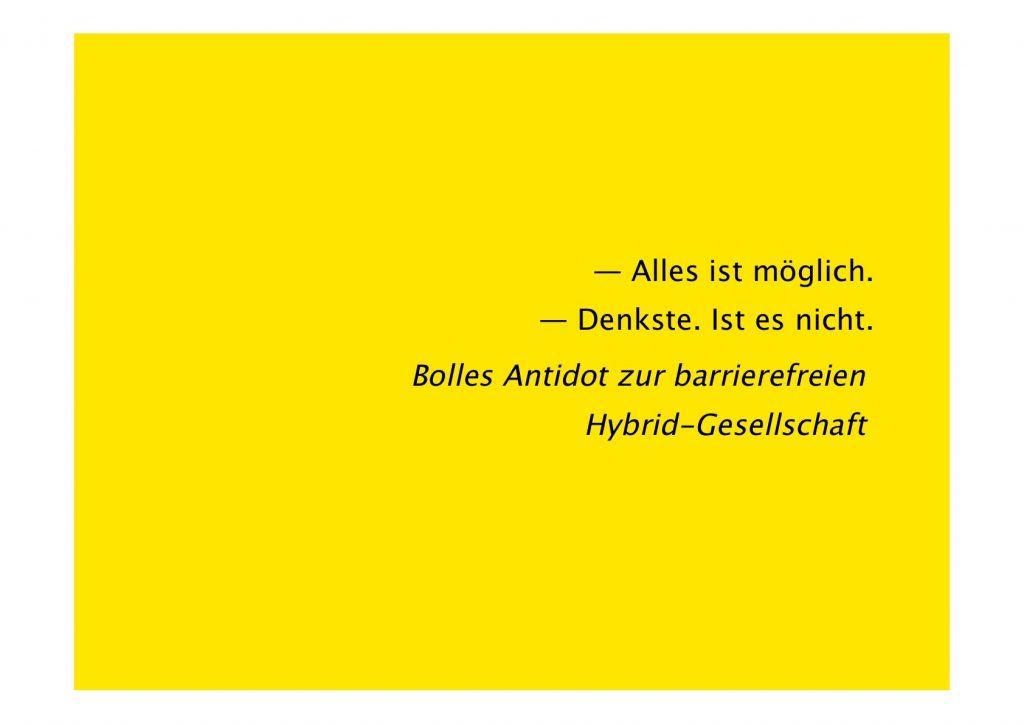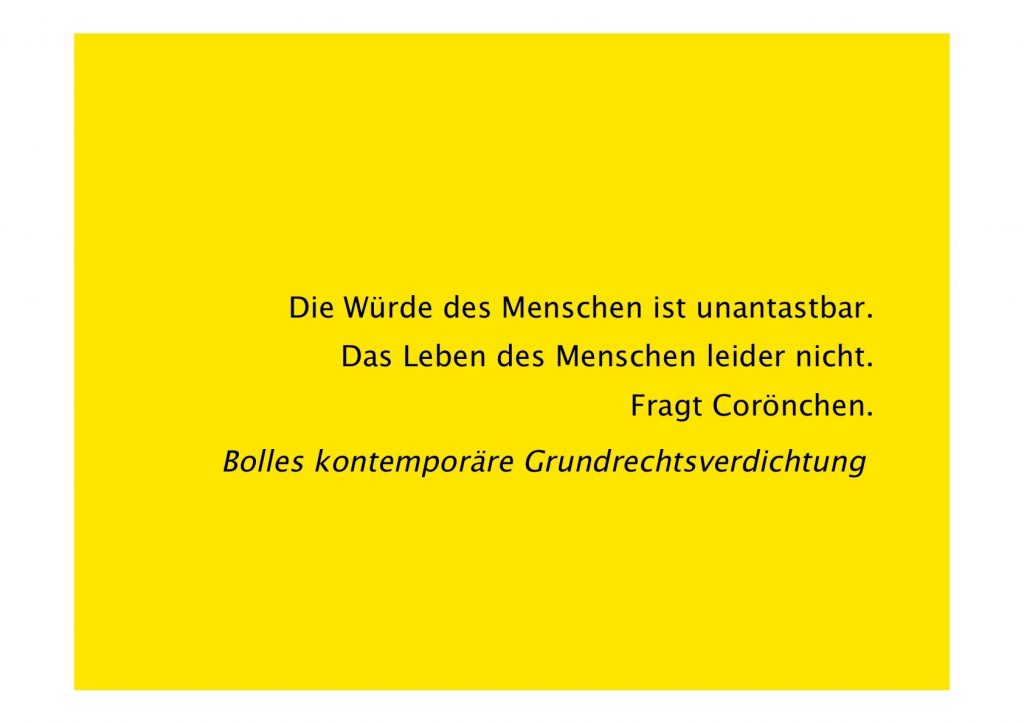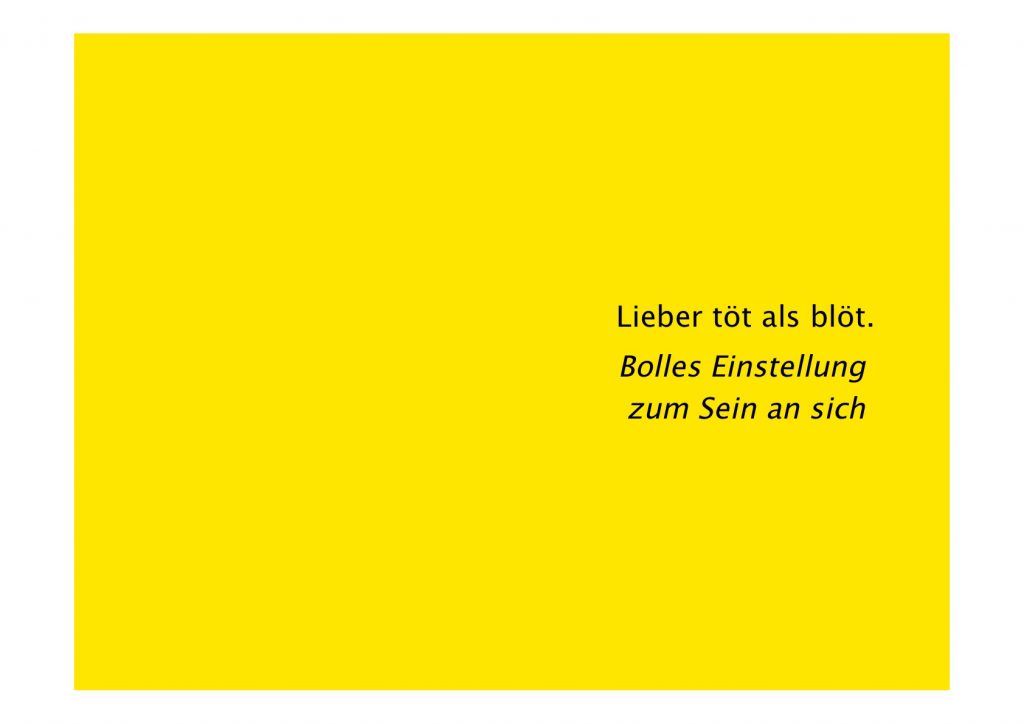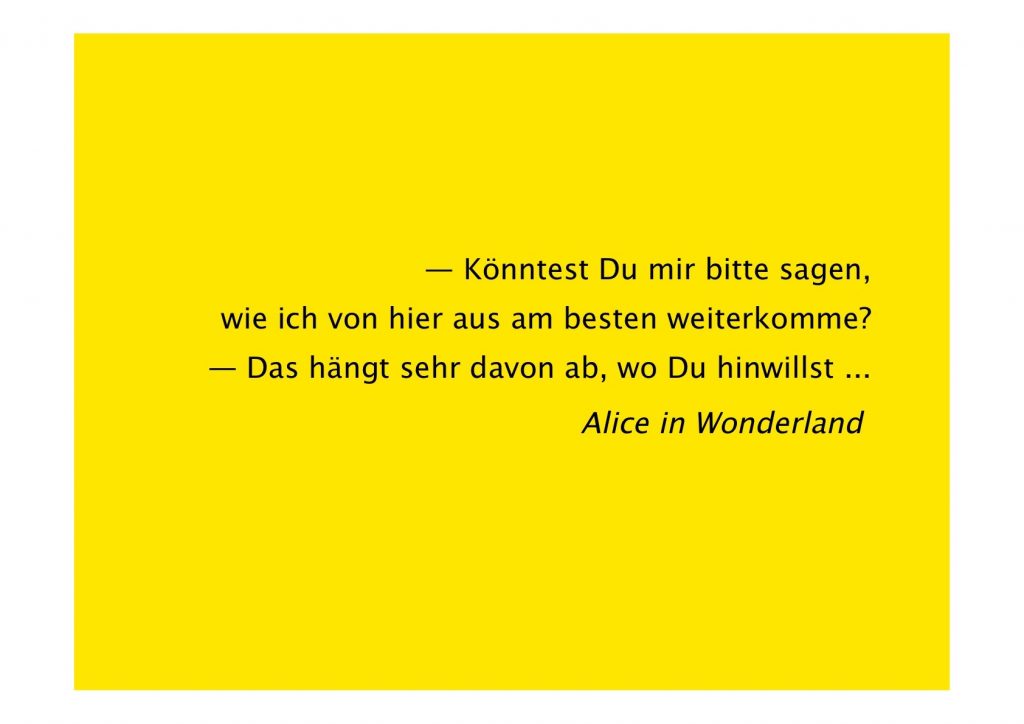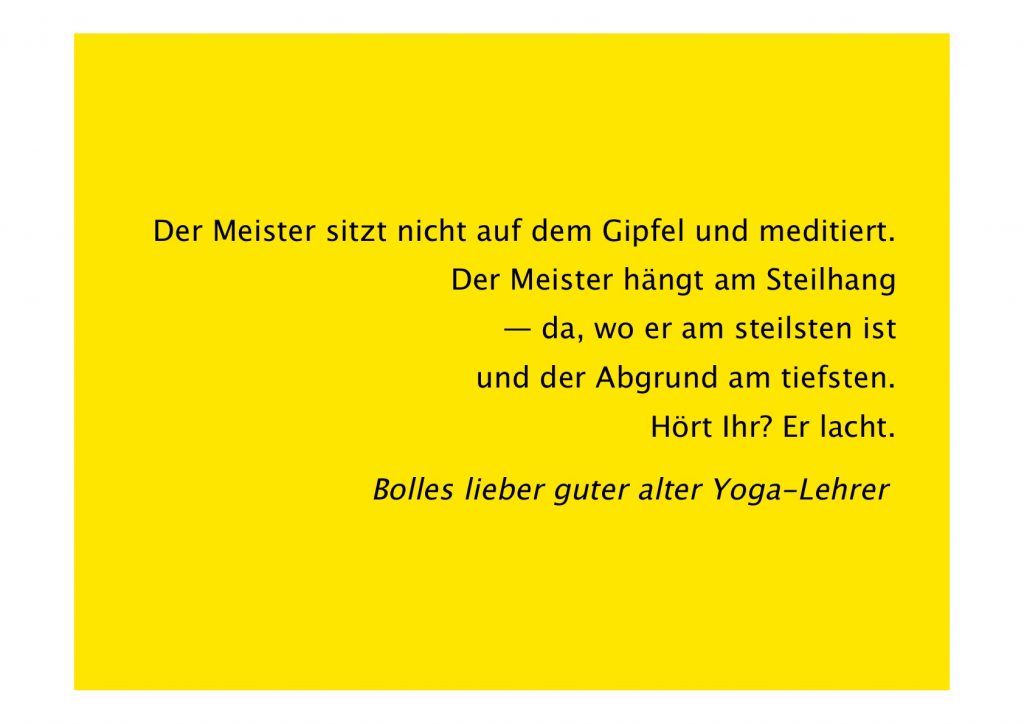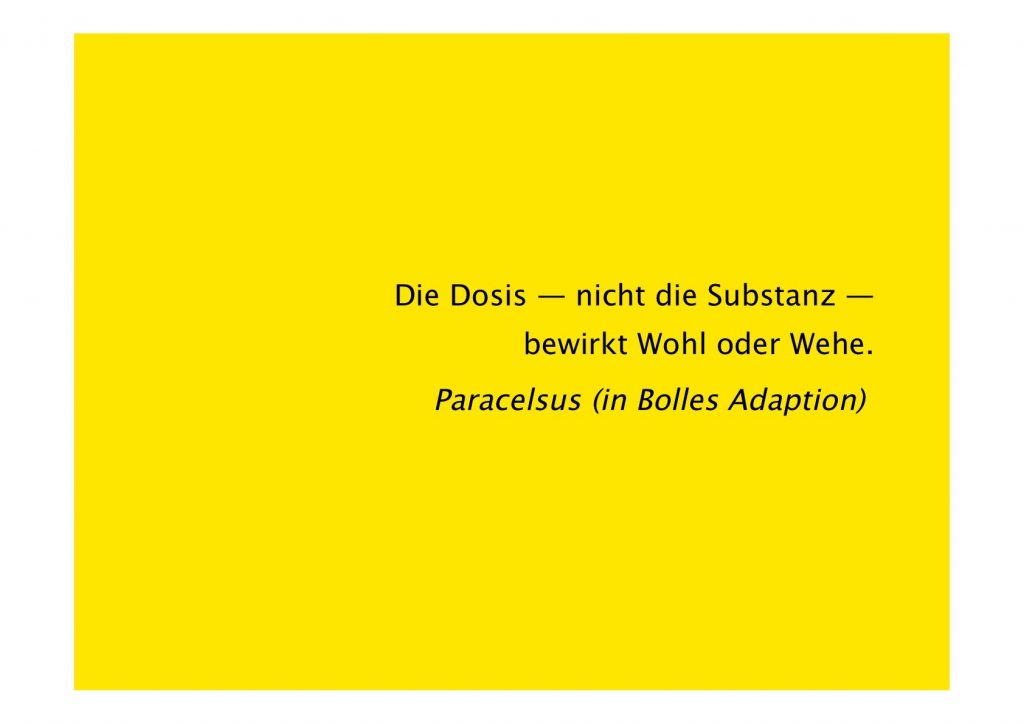
Paracelsus hat sein Statement seinerzeit dem Duktus des ausgehenden Mittelalters entsprechend gefaßt: „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei.“ (Holzinger 2014, S. 79). Daraus wurde dann in verkürzter Form „Nur die Dosis macht das Gift“ bzw., in medizinisch-pharmazeutischem Schlausprech: Sola dosis facit venenum. Letztlich geht es hier aber um die Qualität / Quantität-Polarität – und auch die Wirkungsseite läßt sich zu „Wohl oder Wehe“ verallgemeinern. Eigentlich ist das ja auch klar: „Übermut tut selten gut“, heißt es im Volksmund.
Was übrigens hat Paracelsus zu diesem Statement bewogen? Es waren Anfechtungen seiner lieben, im Zweifel aber weniger begabten Kollegen. Er mußte sich nämlich des öfteren vor Gericht des Vorwurfs erwehren, seinen Patienten „Gift“ zu verabreichen oder gar ein „Heilpraktiker“ zu sein (wie wir das heute nennen würden). Wie sich doch die Bilder gleichen.
Übrigens kann »venenum« nicht nur ›Gift‹, sondern auch ›Heilmittel‹ oder gar ›Zaubertrank‹ bedeuten. Dann wollen wir mal hoffen, daß die Heilsbringer unserer Tage sich nicht in der Dosis vertun und wirklich „Zauberpiekse“ verabreichen – von „Trank“ kann hier ja wohl keine Rede sein. Wir werden sehen. Hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. Das aber ist dann wohl ein anderes Kapitel.