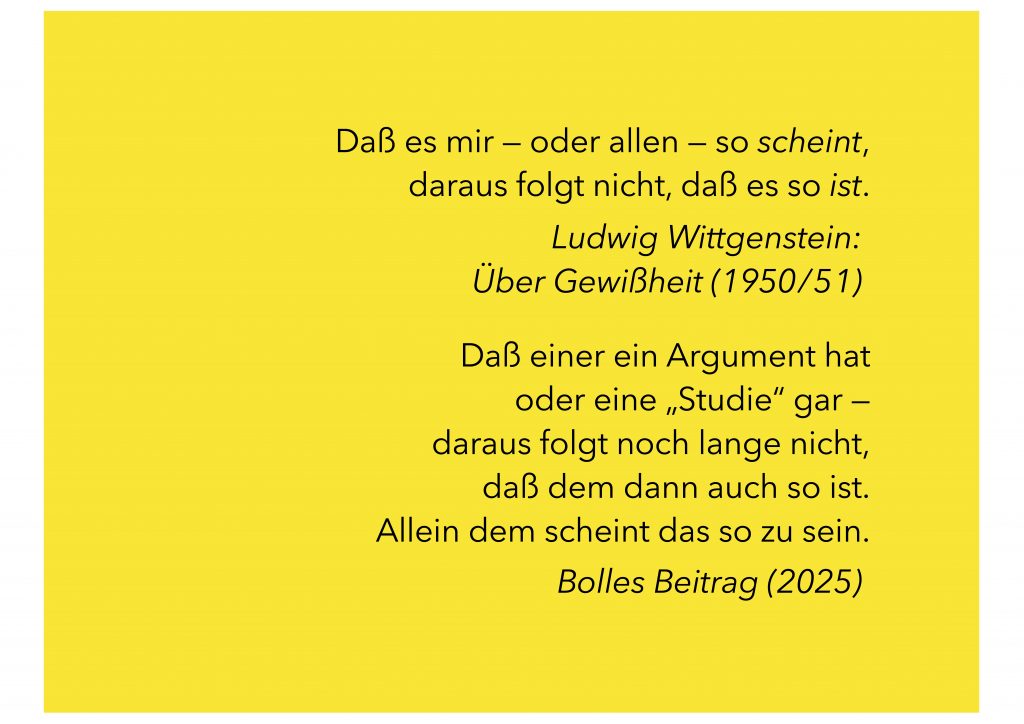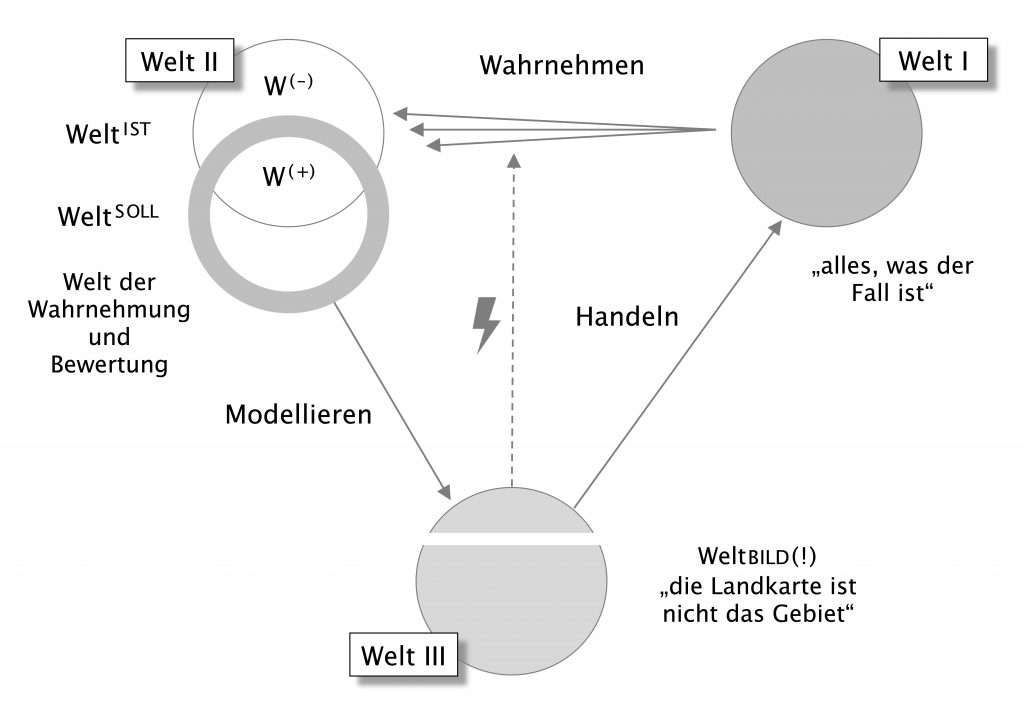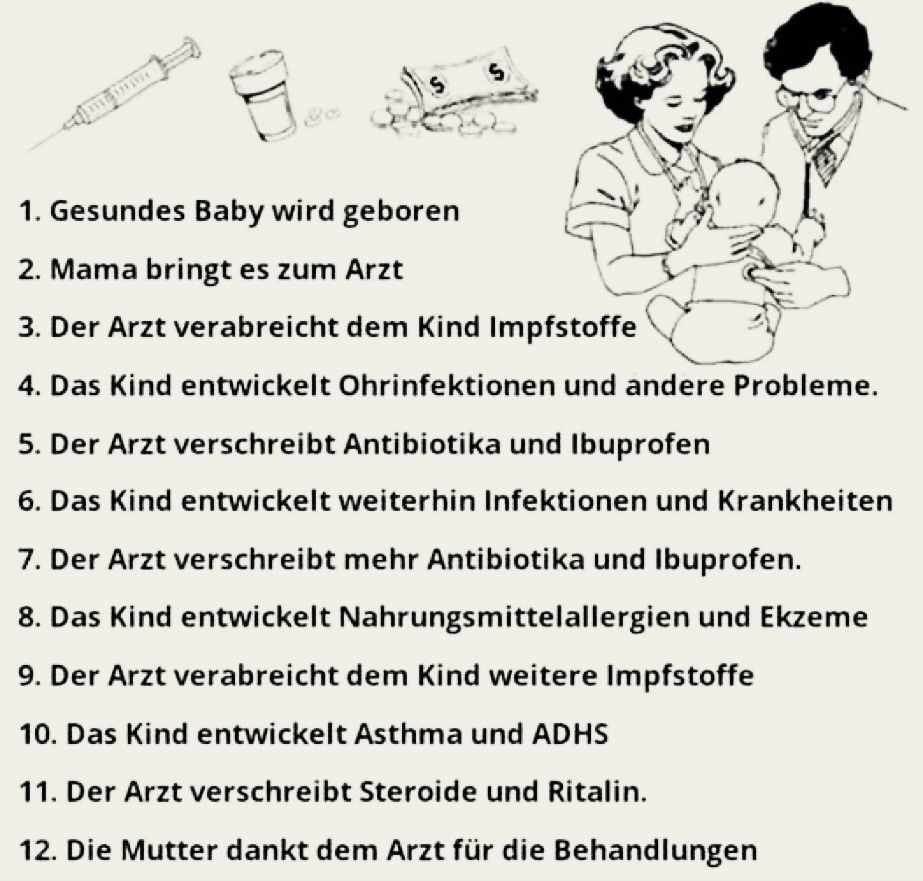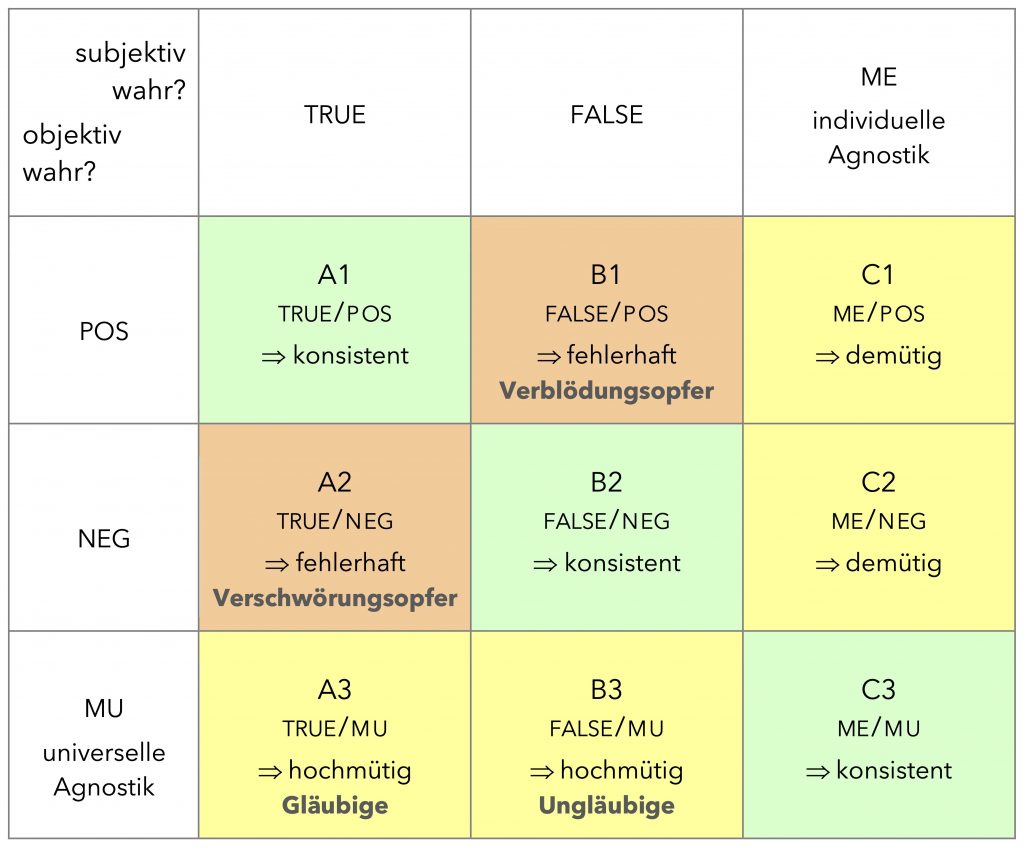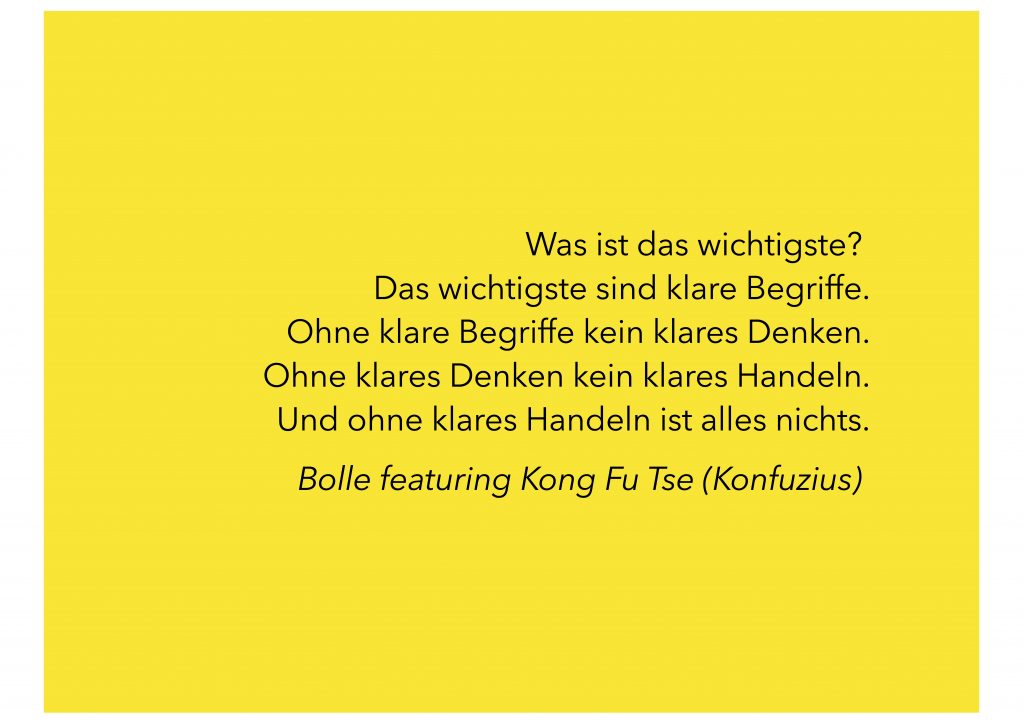Manchmal – nicht allzu oft, aber doch immer mal wieder – kommt Bolle sich vor wie ein Idiot. An und für sich ist das ja nicht weiter bedenklich, weil nur wirkliche Idioten sich niemals als solche fühlen. Aber gleichwohl: Was auf unserem Bildchen so unscheinbar aussieht – das eingekringelte Gläschen Sekt nämlich – hat eine längere Vorgeschichte. Zwar ist die Geschichte an sich nicht allzu lang – allein sie ist schon lange her.
Damals war Bolle in seinem Homeoffice – wie man das heute pseudoanglizistisch nennen würde – jeglicher Büromöbel abhold. Sowas kam ihm mitnichten ins Haus. Und so begab es sich, daß Bolles nigelnagelneuer Laptop (derlei gab es damals schon, wenn auch noch nicht weitverbreitet) auf Teppichhöhe residierte – und ein Gläschen Sekt in unmittelbarer Nachbarschaft.
Es kam, wie es kommen mußte: Schwupps, ein flotter Schwung aus dem Handgelenk – und das wohlgefüllte Gläschen Sekt befand sich stante pede in der Horizontalen. Zwar hatte das Glas an sich den Positionswechsel bestens überstanden – allein der Sekt wollte mit des Rechners Innenleben nicht wirklich harmonieren. Futschikado! Rien n‘allait plus! Und so war unvermittelt Schluß mit Homeoffice in jener Nacht. Genügend Sekt war aber noch da. Ein Glück! Auch wollte der Computerhändler den Laptop umgehend und kostenfrei durch einen neuen ersetzen. Schließlich – doch das nur am Rande – war die Firma, für die Bolle seinerzeit als Chefeinkäufer tätig war, ein Premium-Kunde. Bis auf 100 ml vergossenen Sektes war also nichts passiert.
Gleichwohl fühlte Bolle sich veranlaßt, den Vorfall zu evaluieren: (1) Sekt schmeckt – das sowieso. (2) Sekt schreckt – zumindest, was sensible Maschinchen angeht. Als unmittelbare praktische Konsequenz gab es seitdem bei Bolle Sekt nur noch aus Senfgläsern – natürlich sehr formschönen Senfgläsern, of course. Zwar waren die nicht ganz so dünnwandig, und auch nicht so edel – dafür aber waren sie ausgesprochen standfest. Bolle hatte damals eigens eine mittlere Menge Senf minderer Güte gekauft und in den Abfluß gespült – nur um die Gläser zu haben. Und so war es bis vor wenigen Tagen geblieben.
Die Senf-Sektgläser hat Bolle übrigens heute noch ohne jeden wie auch immer gearteten Abgang. Bei entsprechend pfleglicher Behandlung (keine Spülmaschine, stets einigermaßen aufgeräumte Küche, etc. pp.) haben sie sich als quasi unkaputtbar erwiesen. Die Sektflöten von damals – also die, die Bolle wirklich mag (vgl. dazu Do 04-12-25 Das vierte Türchen: Tempi passati) haben sich umständehalber neulich auch wieder eingefunden. Warum also nicht das Funktionale mit dem Ästhetischen verbinden? Und so kommt es, daß Bolle sich für seinen Sekt eigens einen Logenplatz ausgedacht hat – in Armeslänge zum Küchenstuhl (der Bolle als Arbeitsplatz dient) und trotzdem technisch himmelweit entfernt von sämtlichen sensiblen Gerätschaften. Da sollte eigentlich nichts mehr passieren dürfen.
Allein Bolle wäre nicht Bolle, wenn er der Sache nicht mathematisch auf den Grund gegangen wäre: Und so kam es denn heraus, daß bei den Sektflöten ein Neigungswinkel von gerade mal 15° (gerechnet in üblichen Altgrad mit 360° als Vollwinkel) ausreicht – und das Glas liegt auf der Nas‘. Und das bei einem Schwerpunkt, der sich in so luftigen Gefilden wie zwei Dritteln der Glaseshöhe – zumindest aber der Füllstandshöhe – befindet. Zum Winkel stelle man sich ein Tortenstück vor, das nach alter Väter Sitte (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) ein Zwölftel einer Torte ausmacht, und das dann noch einmal halbiert. 15° sind also wirklich nicht viel – und so ist es gar nicht schwör mit dem Malheur. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.