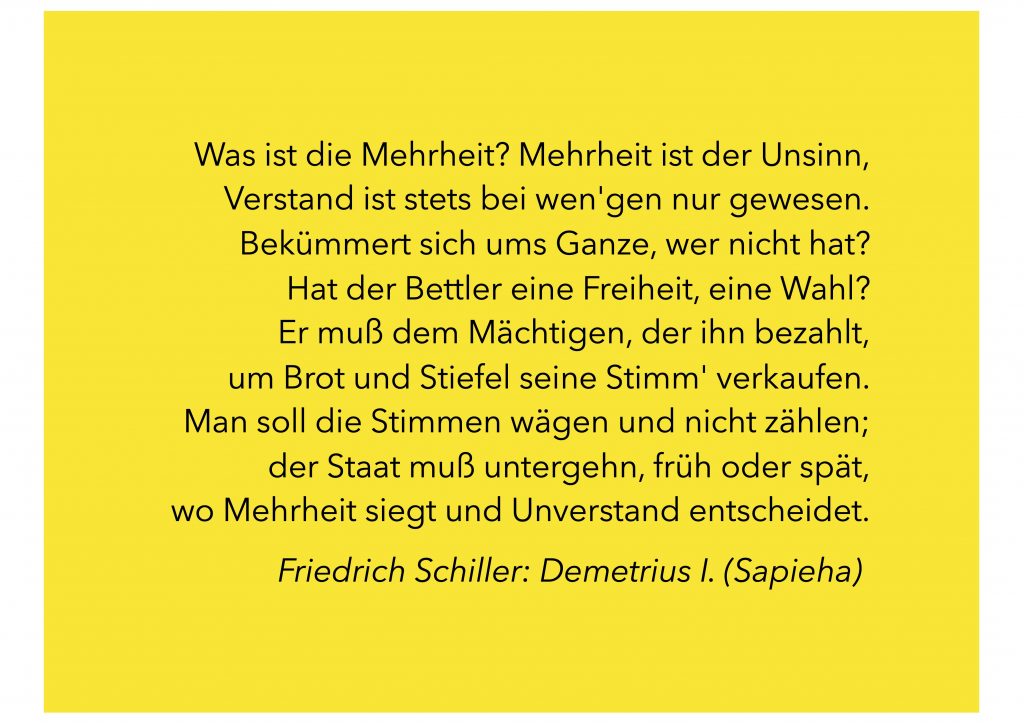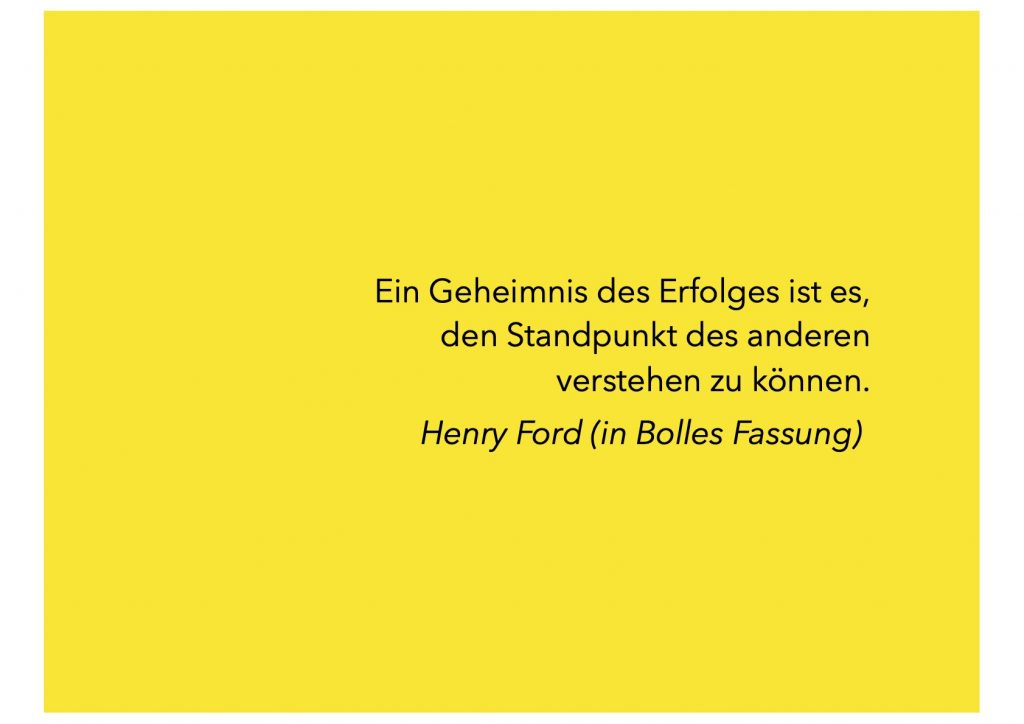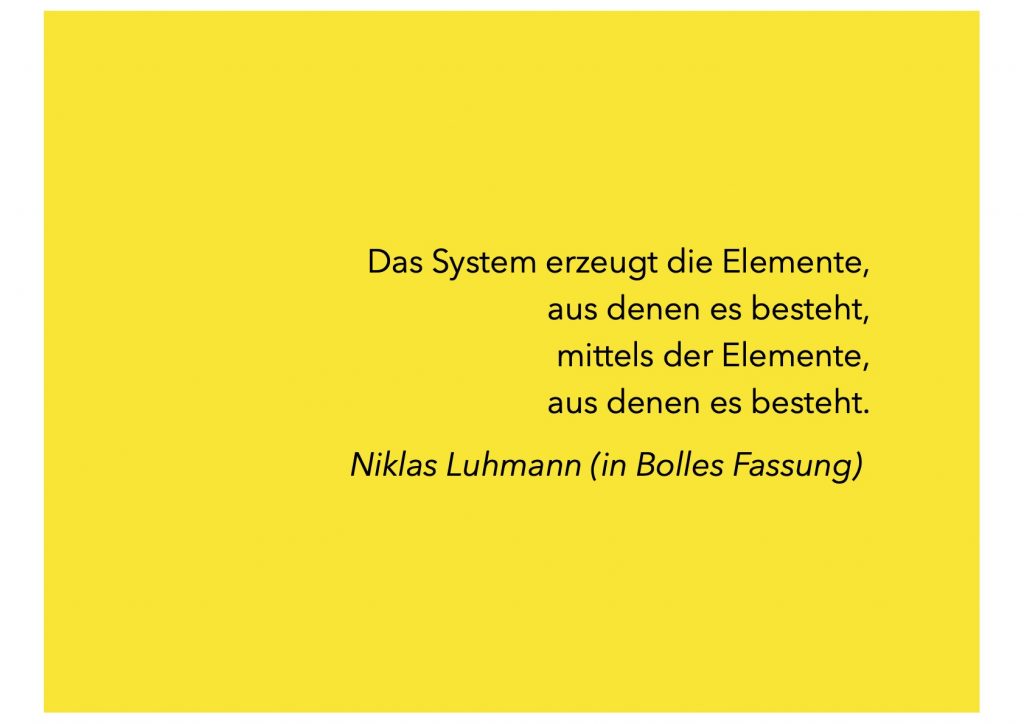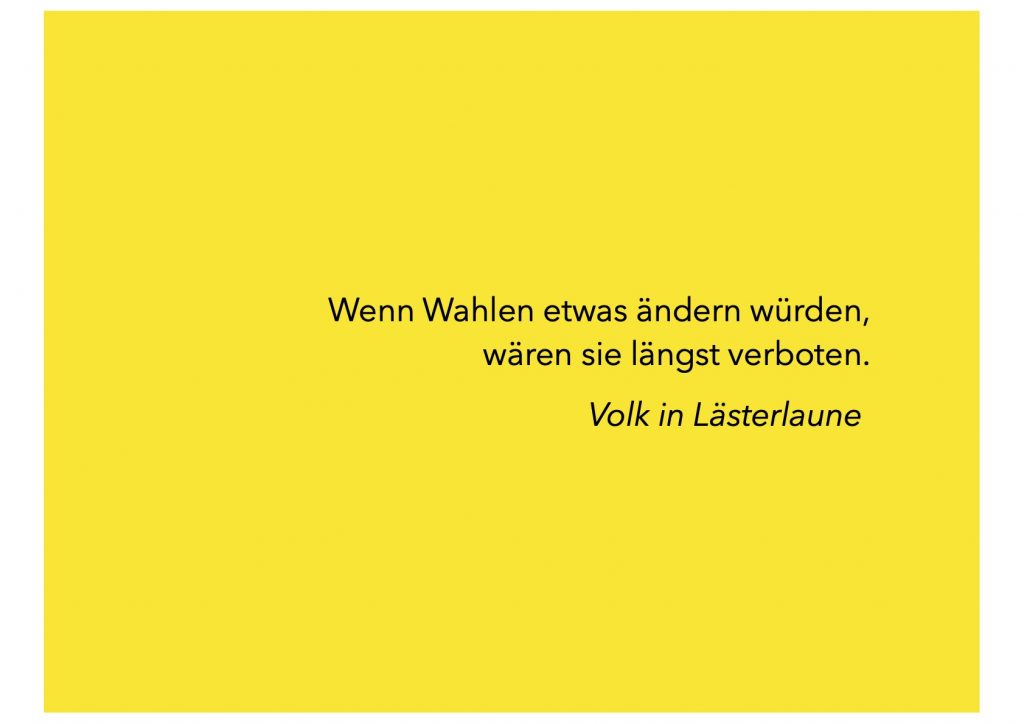Nach den Weihen deutscher Weihnachtsmärkte bzw. deren Derangement in Form von Winterwunderwelten, mit denen wir uns die letzten beiden Tage befaßt hatten – hier zur Abwechslung mal wieder ein ausgesprochen weltliches Thema. AODSCH!
AODSCH ist Bolles jüngstes Akronym für ›Als-Ob-Demokratie-Schietkram‹. Darf man das so sagen? Bolle meint: man muß! Es rumort ja durchaus schon länger im Gebälk. Anlaß – lediglich der Anlaß – für unseren heutigen Beitrag sind die mißratenen Wahlen in Rumänien, of course. Dort fiel dieser Tage ein Urteil des obersten Gerichtes in etwa wie folgt aus:
Im Namen des Volkes! Ihr, das Volk, seid zu blöd zum Wählen. Also zurück auf Los, marsch, marsch!
Natürlich hat das niemand so formuliert. Aber im Tenor ist genau das gemeint. Möglicherweise ist das Volk ja wirklich zu blöd. Dann muß das wohl auch mal gesagt werden dürfen. Aber derlei ›Im Namen des Volkes‹ zu verkünden, mutet dann doch ein wenig skurril an. Und das ganze dann auch noch als ›Demokratie‹ zu verkaufen – eine Staatsorganisationsform, in der alle Staatsgewalt vom Volke auszugehen hat – selbst, wenn es nun mal zu blöd sein sollte. Was wäre die Alternative? Ein besseres Volk? Oder ganz zumindest eben eine ›Als-ob-Demokratie‹, die so tut, als ob – dabei aber niemandem in den höheren Schichten ernstlich wehtut. Merkwürdig – sehr, sehr merkwürdig das, in der Tat.
Man könnte fast meinen, daß so etwas wie ›Demokratie‹ nur dann und nur so lange funktioniert, wie das Volk sich an der Urne angemessen brav verhält. Diese Partei wählen oder jene – geschenkt. Solange die alle das gleiche wollen im Prinzip, wird das nicht weiter stören. Aber so richtig danebenwählen? Das ist nach Ansicht mancher mehr als die stärkste Demokratie abkann. Immerhin ist das ein Indiz für die Richtigkeit von Bolles Partizipationsplacebo-Theorem (vgl. dazu etwa Mo 12-12-22 Das zwölfte Türchen …). Gib den Leuten das Gefühl, daß sie was zu sagen haben – zum Beispiel wählen gehen dürfen. Das fördert das Commitment und damit die Zufriedenheit. Allerdings muß man höllisch darauf achten, daß sie nicht wirklich was sagen – also zum Beispiel völlig falsch wählen. Das ginge dann doch zu weit.
Und? Wie sieht es hierzulande aus? Noch nicht ganz so offenkundig, aber auf dem besten Wege, wie zu befürchten steht. Bolle muß da an die letzten Wahlen im Osten denken, Brandmauern und nicht zuletzt Verbotsphantasien für bestimmte Parteien. Irgendwie muß das Volk ja auf den rechten Weg geführt werden.
Was schließlich sagt die freie Presse, der Journalismus 2.0? Irritierend wenig. Rumänien sei ein EU-Land und überdies in der NATO – da sei es nun mal nicht tunlich, einen Präsidenten zu wählen, der da nicht voll und ganz dahinterstehen mag. Das könne und müsse man ja verstehen. Nun ist es wirklich nicht jedermanns (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) Sache, die Bedeutung von Nachrichten einschätzen und beurteilen zu können. Allerdings fragt Bolle sich manchmal: warum dann Journalist werden? Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.