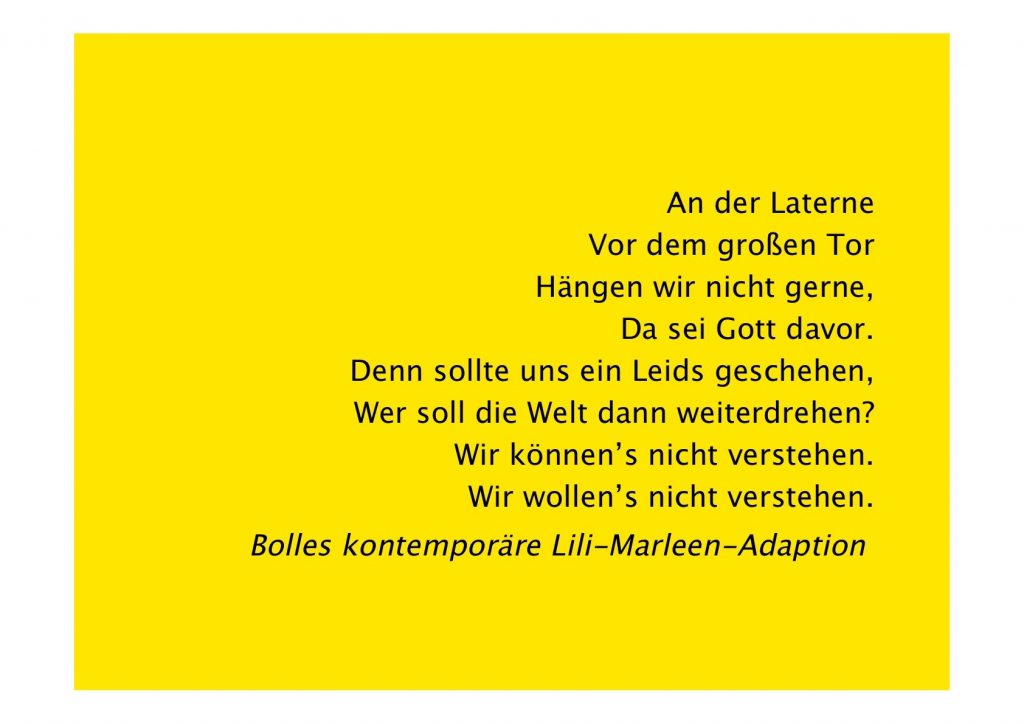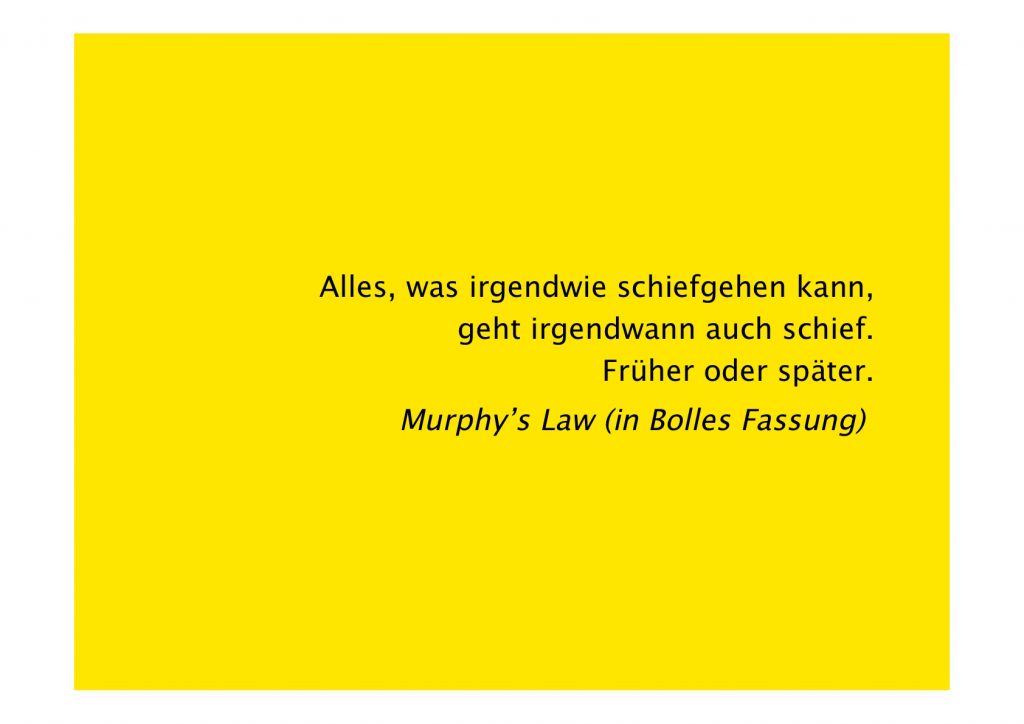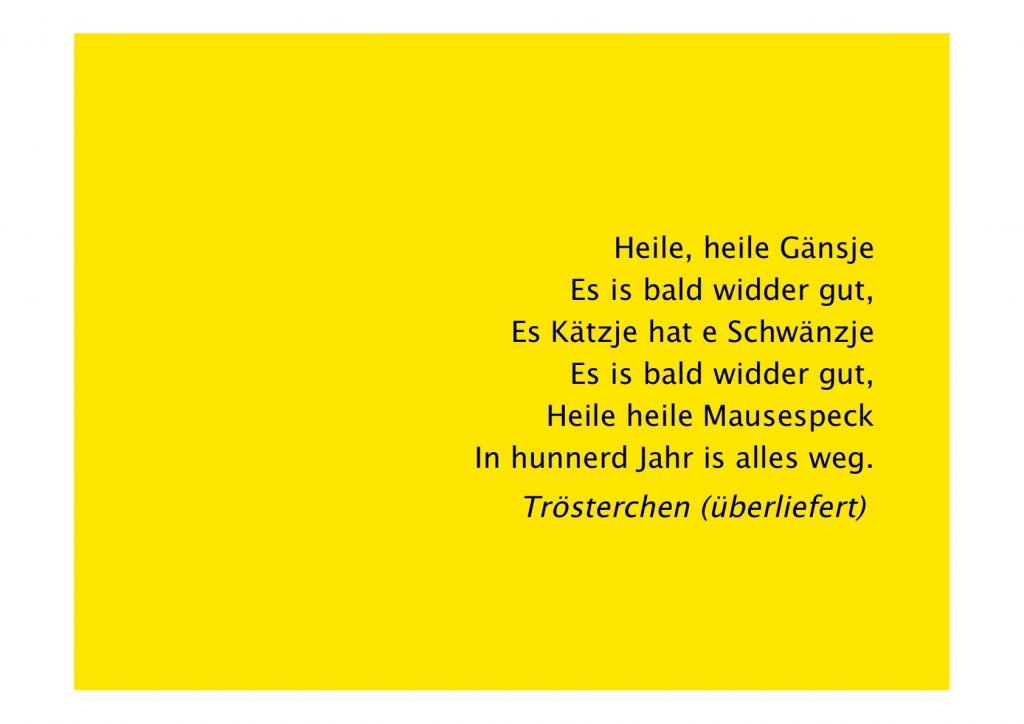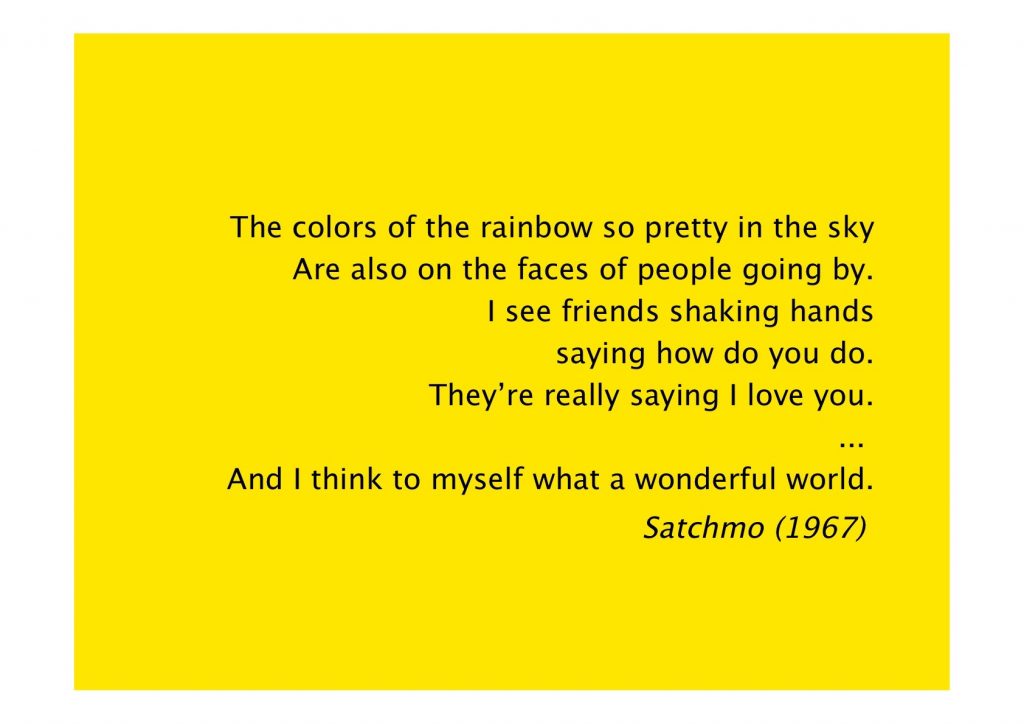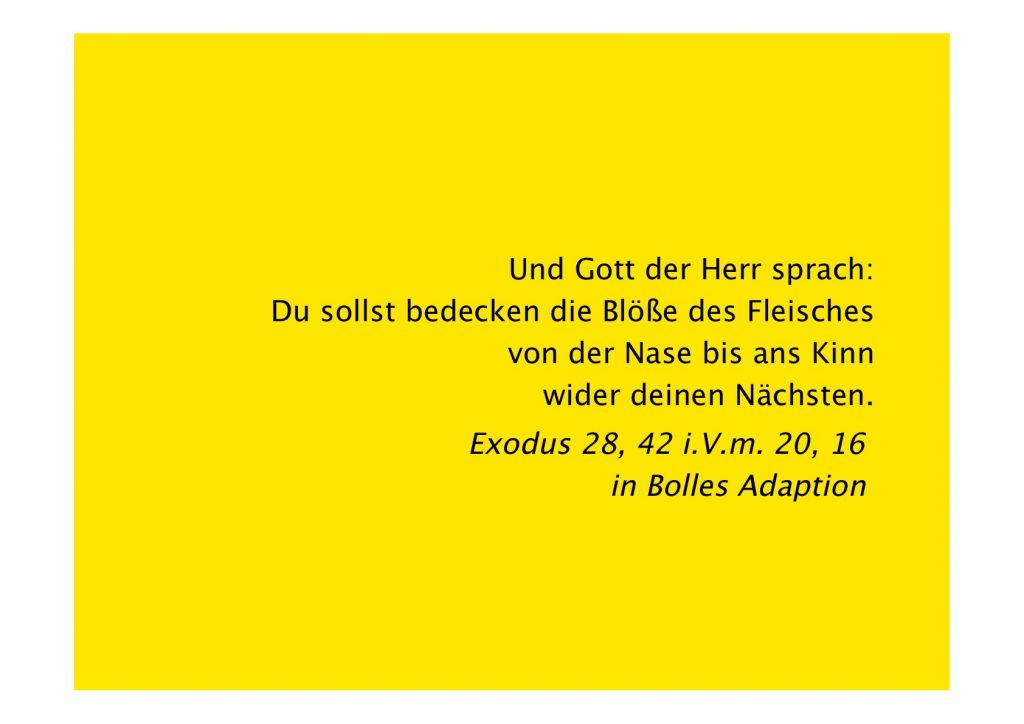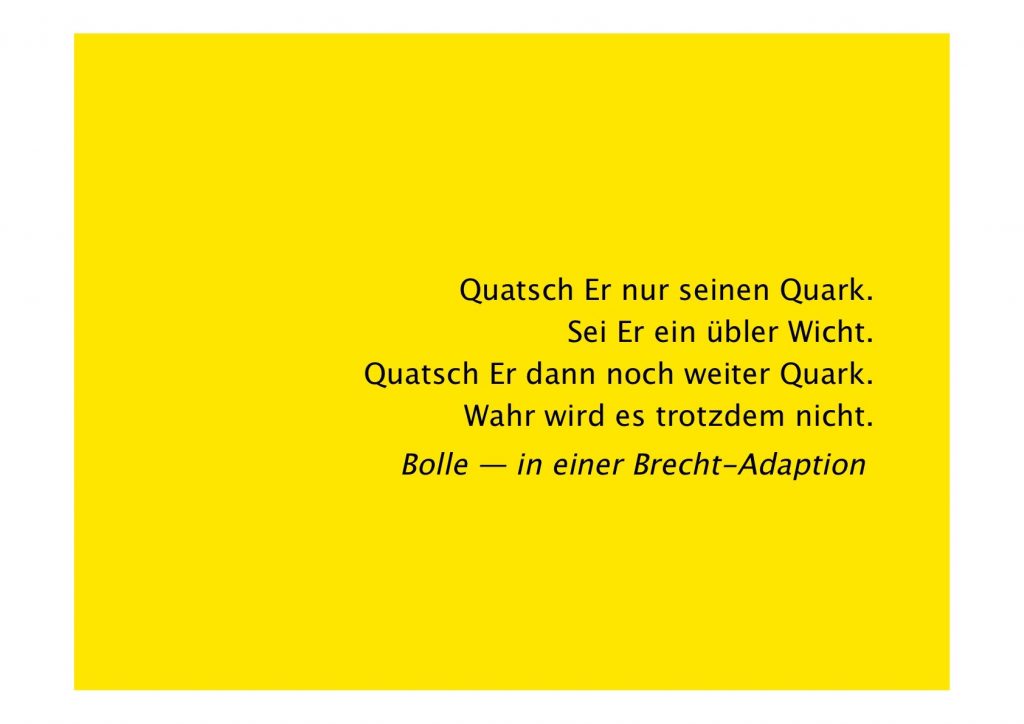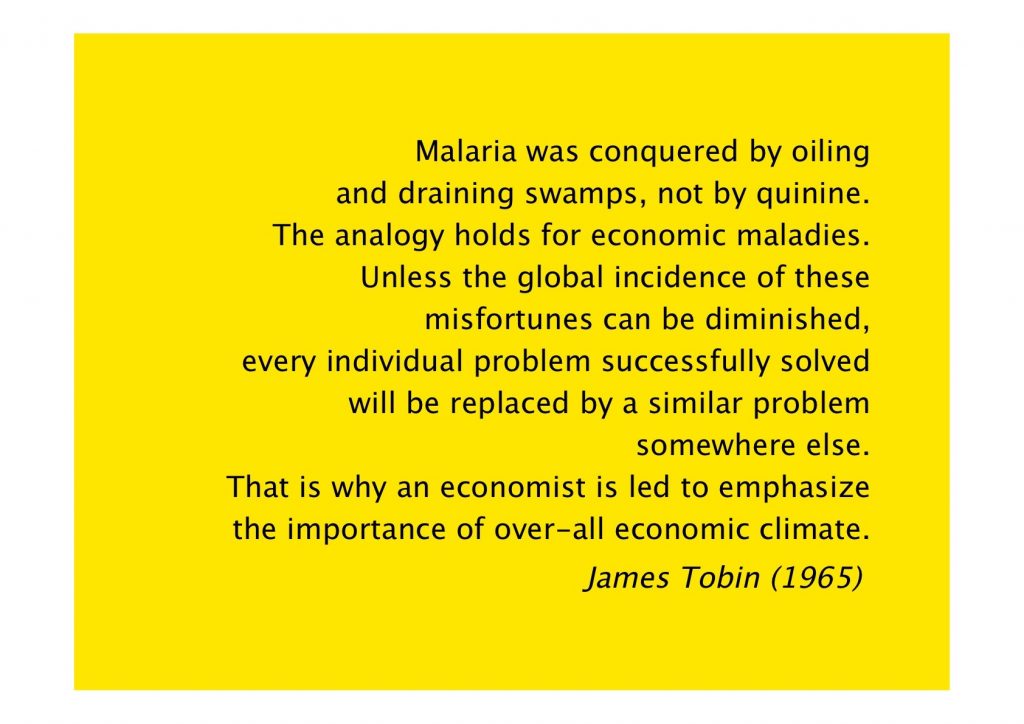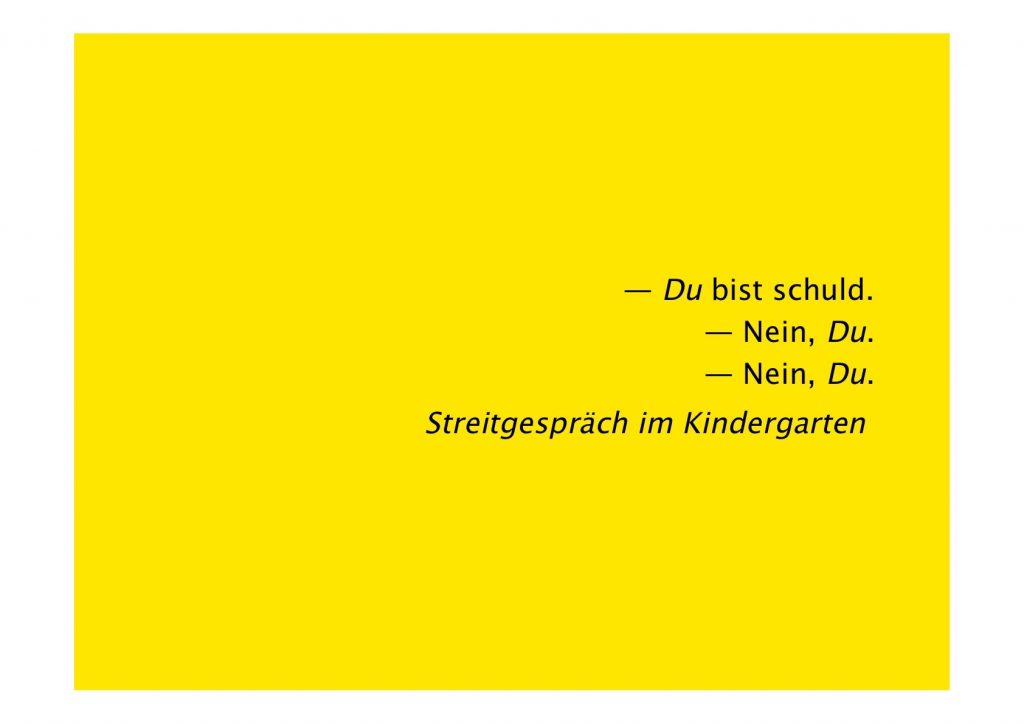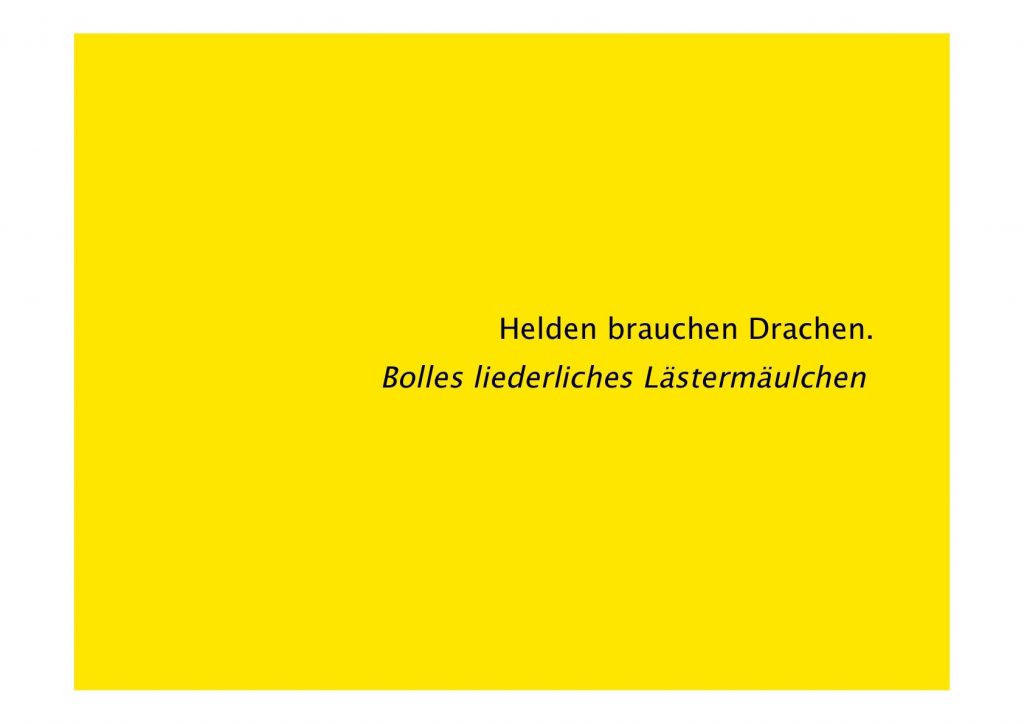
Bolle, ist das nicht etwas unfair? Regelrechte „Breaking News“ waren das ja dann doch nicht. – Hätte aber nicht viel gefehlt. Immerhin war das auf vielen Kanälen, die sich selber als völlig seriös durchgehen lassen würden, die Hauptnachricht. Wir haben Winter. Und es schneit. Na toll! Irre interessant. Wenn wir jetzt mitten im Juli wären und ähnliche Schneeverhältnisse hätten: Das wäre eine Nachricht. So aber haben wir es hier schlicht und ergreifend mit „Null-News“ zu tun: Nachrichten, die keine sind.
Aber darum geht es auch gar nicht. Worum dann? Bolle sieht in der Berichterstattung eine Spielart der immer mehr um sich greifenden Helden-Verherrlichung. Wobei Helden auch nicht mehr das sind, was sie mal waren. Während sich ein klassischer Held damit hervorgetan hat, seinen Widersachern – Drachen zum Beispiel oder gern auch gegnerischen Truppen – den Kopf abzuschlagen, sind die heutigen Helden 2.0 durch und durch Menschenfreund. Hier wird niemandem der Kopf abgeschlagen. Im Gegenteil: Helden 2.0 zeichnen sich dadurch aus, daß sie „retten“, wo immer es irgendwie was zu retten gibt. Beispiel: Irgendein Dummkopf fährt bei widrigen Verkehrsverhältnissen mitten ins Schneetreiben auf der Autobahn. Keine Sorge: der Retter naht und befreit mit schwerem Gerät und, wenn die Presse naht, noch schwererer Geste die hilflosen (mit Verlaub) Hirnis aus ihrer mißlichen Lage – in die sie sich allerdings aus freien Stücken überhaupt erst hineinmanövriert haben. Immerhin: Damit kann man ganze Vorabend-Sendungen füllen. Wer so was für gewöhnlich nicht gucken mag wird dann eben auf die Hauptnachrichten verwiesen: Same procedure as everywhere.
Aber natürlich muß es nicht immer ein Schneetreiben sein. Tummelplätze für Helden 2.0 finden sich allerorten. Da erklärt zum Beispiel ein ehemaliges It-Girl (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course), dem es aktuell an Aufmerksamkeit zu gebrechen scheint, welch schwere Kindheit es seinerzeit doch gehabt habe – vor gefühlt hundert Jahren, also. Statt aber einfach zu sagen: „Shut up, baby, Du bist mit Deinem Heldenmut locker ’n paar Jahrzehnte zu spät dran. Der Drache ist längst tot. Komm damit klar. Im übrigen gibt es in zivilisierten Gesellschaften aus sehr, sehr guten Gründen so was wie Verjährung“ – erfahren wir, wie mutig, ja wie „heldenhaft“ es doch sei, nach so vielen Jahrzehnten endlich die sprichwörtliche Scheiße wieder aufzuwühlen. Bolle meint: Wahre Helden handeln jetzt – und nicht aus der sicheren Deckung mehrerer vergangener Jahrzehnte heraus. Man könnte auch sagen: Manche der modernen Helden 2.0 ziehen sich ihre Drachen aus dem Hut wie sonst nur der Magier die Kaninchen.
Kurzum: Es ist nicht alles Held, was glänzt – bzw. auch nur versucht, den eigenen Glanz nachträglich ein wenig aufzupolieren. Aber wenn’s doch so im TV kommt? Nun, das sagt mehr über das TV aus als über den Heldenmut der Helden. Im übrigen wäre das dann auch schon wieder ein anderes Kapitel.