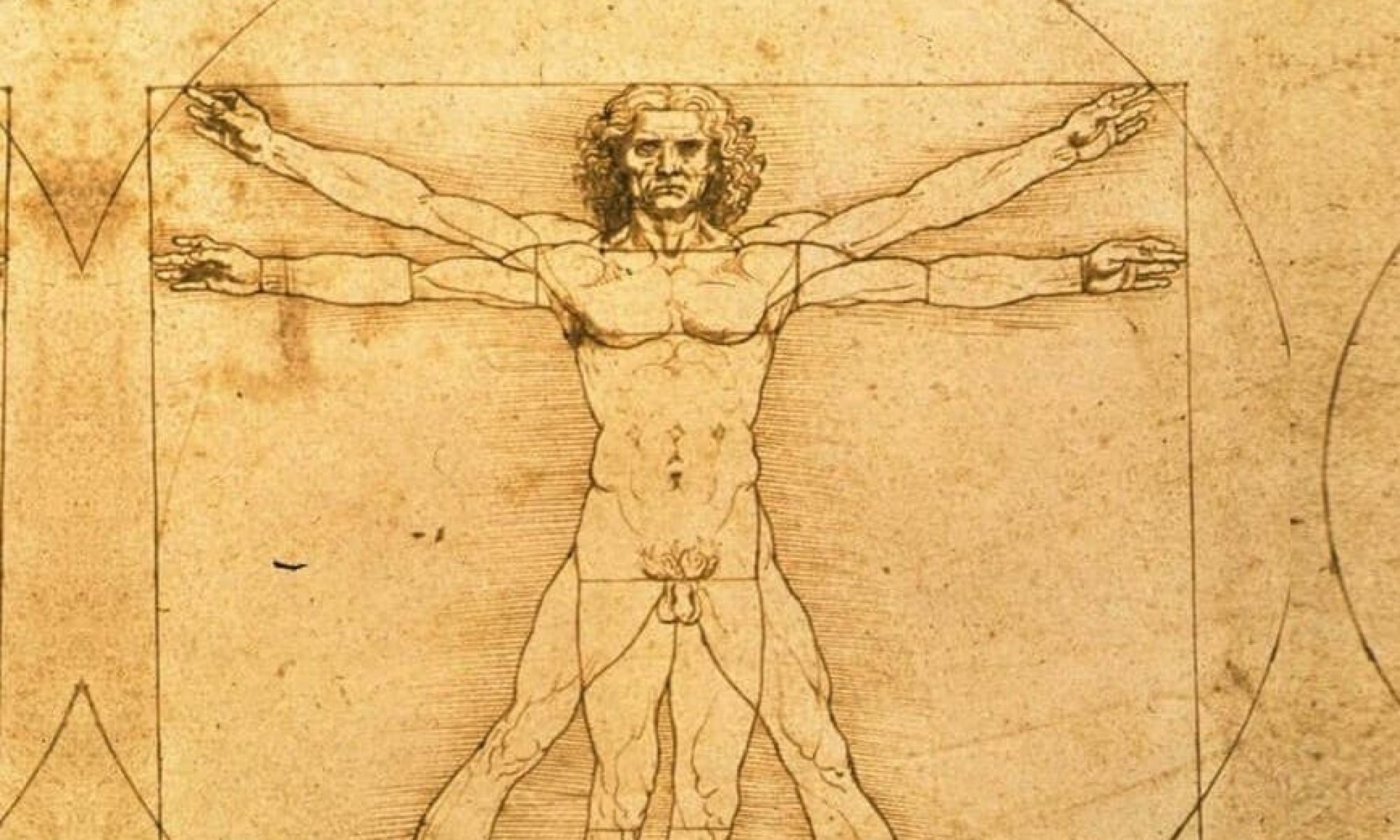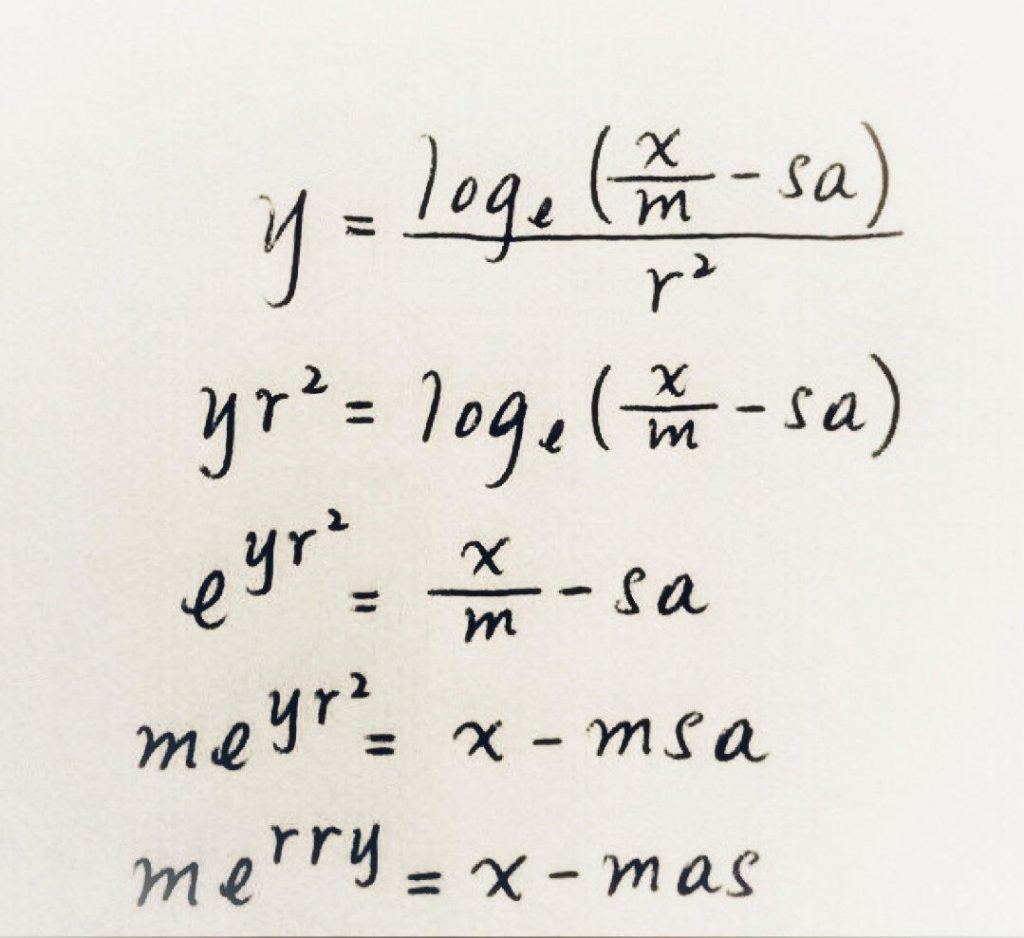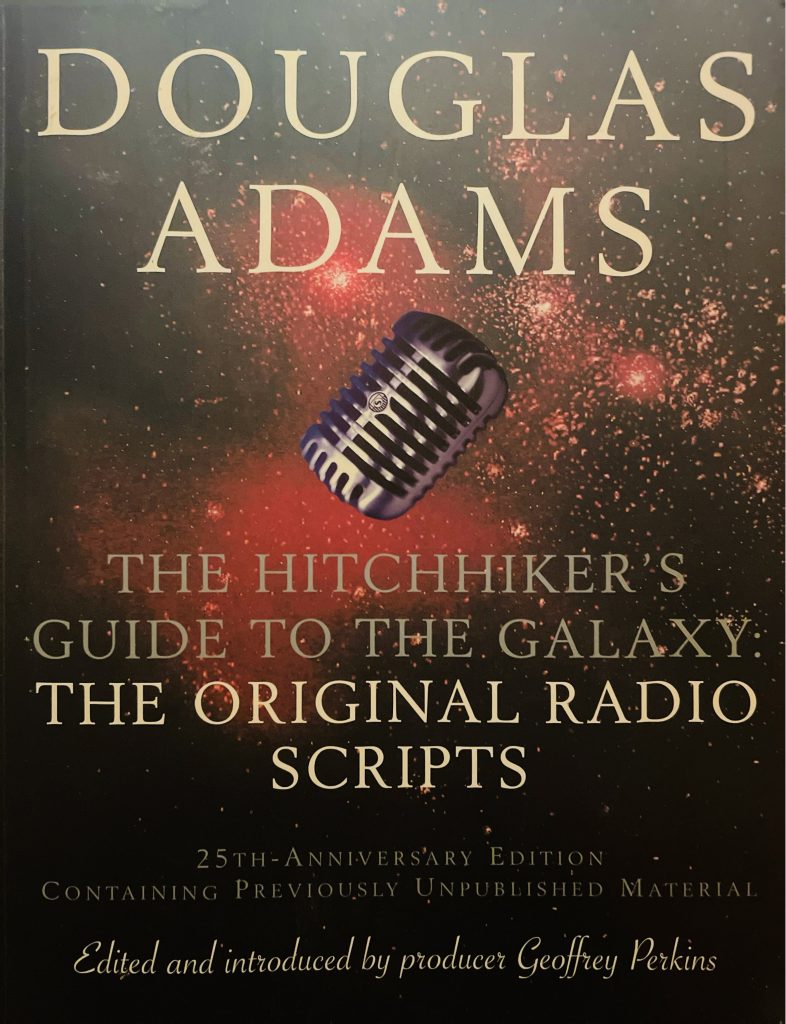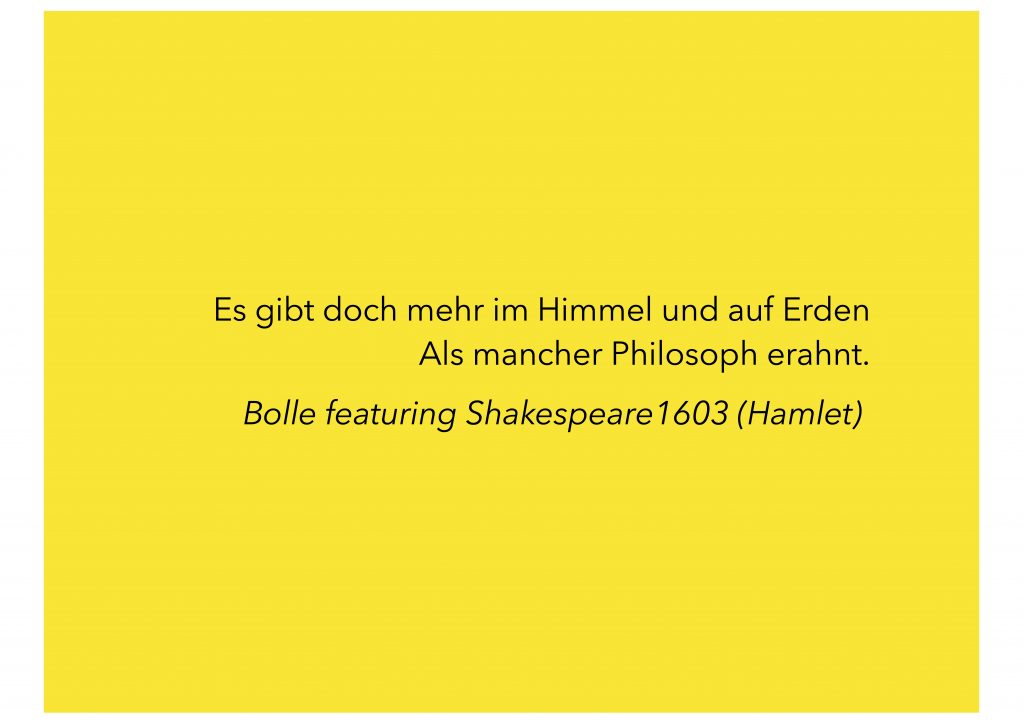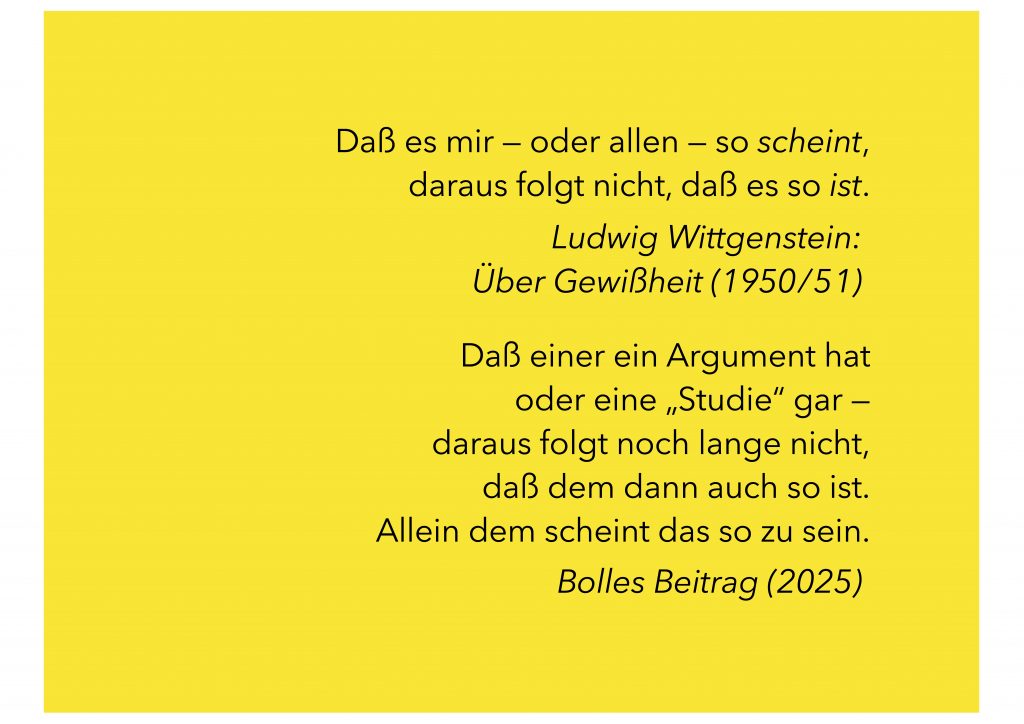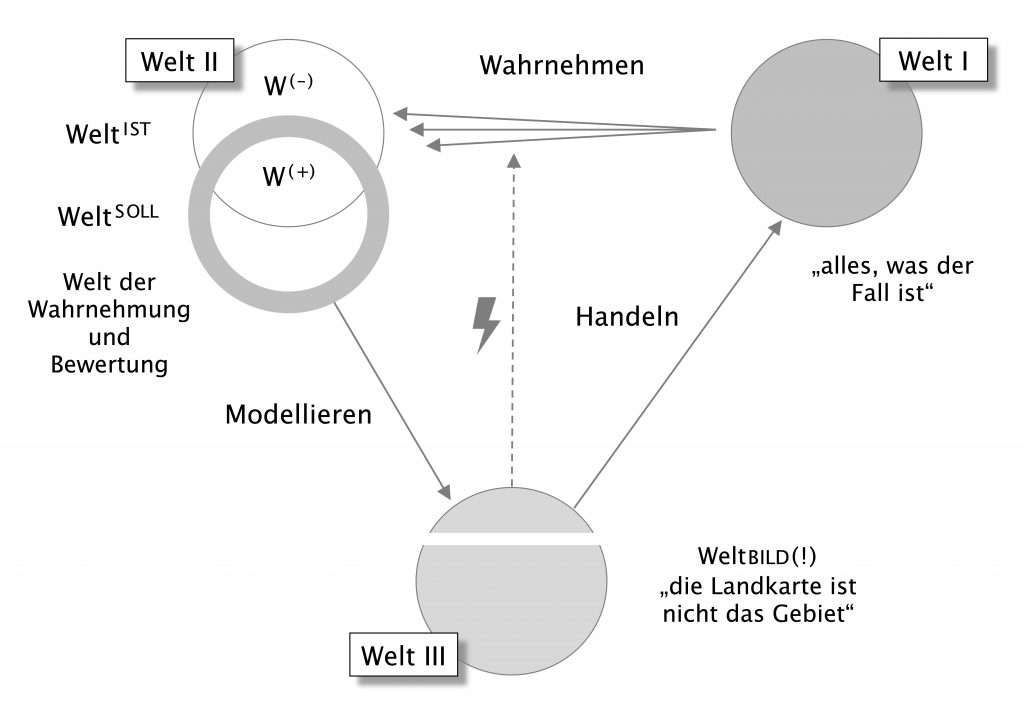Tja – so kann’s gehen. Kaum haben wir das letzte Türchen unseres diesjährigen agnostisch-kontemplativen Adventskalenders geöffnet, da rücken auch schon wieder die Sonntagsfrühstückchen heran. Et voilà. Immerhin ist es das letzte für dieses Jahr – und Bolle verspürt wenig Neigung, jetzt schon wieder in die laute und lärmende Welt da draußen einzutauchen. Zwischen den Jahren herrsche bitteschön Ruhe. Das war bei Bolle schon immer ein sozusagen geheiligter Grundsatz. Halten wir es also mit Erich Kästner. Der nämlich hat sich in seinem ›Die 13 Monate‹ 1955 schon einen Reigen durch das Jahr gereimt. Für ›Dezember‹ heißt es dort:
Das Jahr wird alt. Hat dünne Haar.
Ist gar nicht sehr gesund.
Kennt seinen letzten Tag, das Jahr.
Kennt gar die letzte Stund.
Dabei schließt er seine Dezember-Elegie mit den Worten:
Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag.
Dann dröhnt das Erz und spricht:
„Das Jahr kennt seinen letzten Tag,
und du kennst deinen nicht.“
Bolle findet, das passe doch recht trefflich zu unserem diesjährigen unterschwelligen ›Last Christmas‹-Tenor – vergleiche dazu nicht zuletzt Mi 24-12-25 Das vierundzwanzigste – und für dieses Jahr letzte – Türchen: Last Christmas.
Wer noch etwas wohlig-wärmendes sucht für die ja erst noch kommenden kälteren Wintermonate, der möge es vielleicht mit Ashley Davis‘ ›Songs of the Celtic Winter‹ (2012) probieren. Dort findet sich als letztes Lied auch eine sehr schöne Fassung von ›Auld Lang Syne‹. Zum einen handelt es sich dabei um ein traditionelles – in den keltischen Regionen der Insel geradezu unverzichtbares – Lied zum Jahresausklang. Bei sensibleren Gemütern soll damit aber auch der im zurückliegenden Jahre Verstorbenen gedacht werden. So gesehen findet Bolle es sehr stimmig. Eine unserer Leserinnen (nein, diesmal nicht beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) mit einer gewissen Affinität zum Althergebrachten hat uns darauf aufmerksam gemacht. Besten Dank dafür.
Unser heutiges Bildchen stammt übrigens aus dem Kurz- und Kultfilm ›Ein Münchner im Himmel‹ (1970 / gezeichnet von Traudl und Walter Reiner, gesprochen von Adolf Gondrell) nach einem Text von Ludwig Thoma (1911). Es erzählt die Geschichte von Alois Hingerl, ehemals Dienstmann Nr. 172 auf dem Münchner Hauptbahnhof, der, einmal entleibt, als Engel Aloisius seine liebe Not hatte im Zwiespalt zwischen himmlischer Hausordnung und bairischer Lebenslust. Aber der Herrgott wäre nicht der Herrgott, wenn er nicht qua göttlichen Ratschlusses eine Lösung gefunden hätte. Und Aloisius wäre nicht Aloisius, wenn die Lösung denn auch funktioniert hätte. Könnt ja ma kieken. Gibt’s in der Mediathek. Das alles aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.