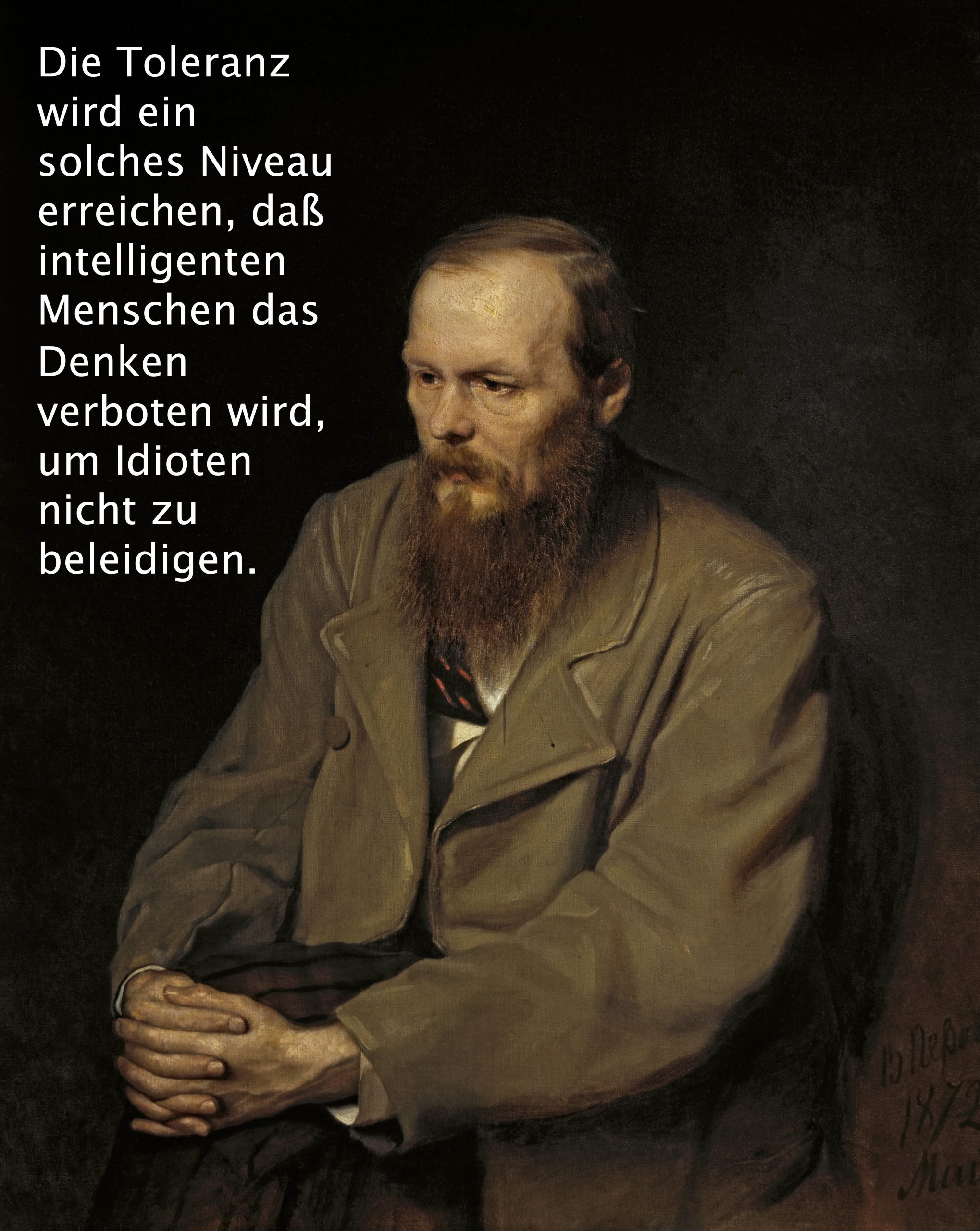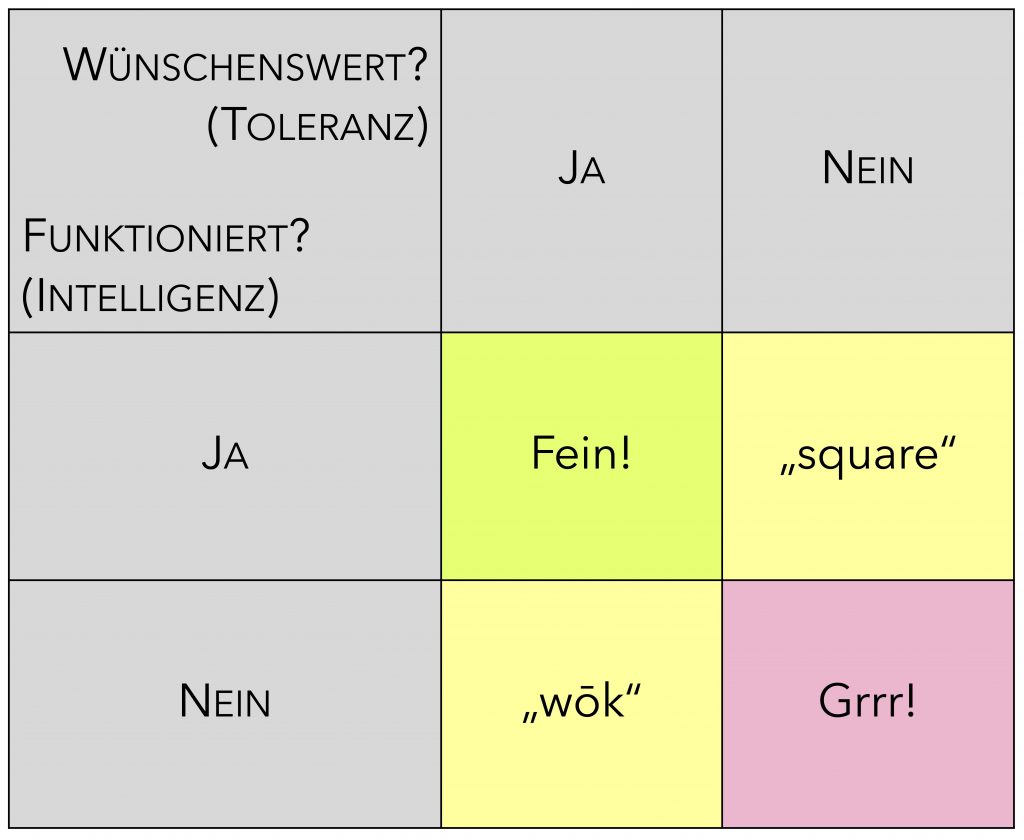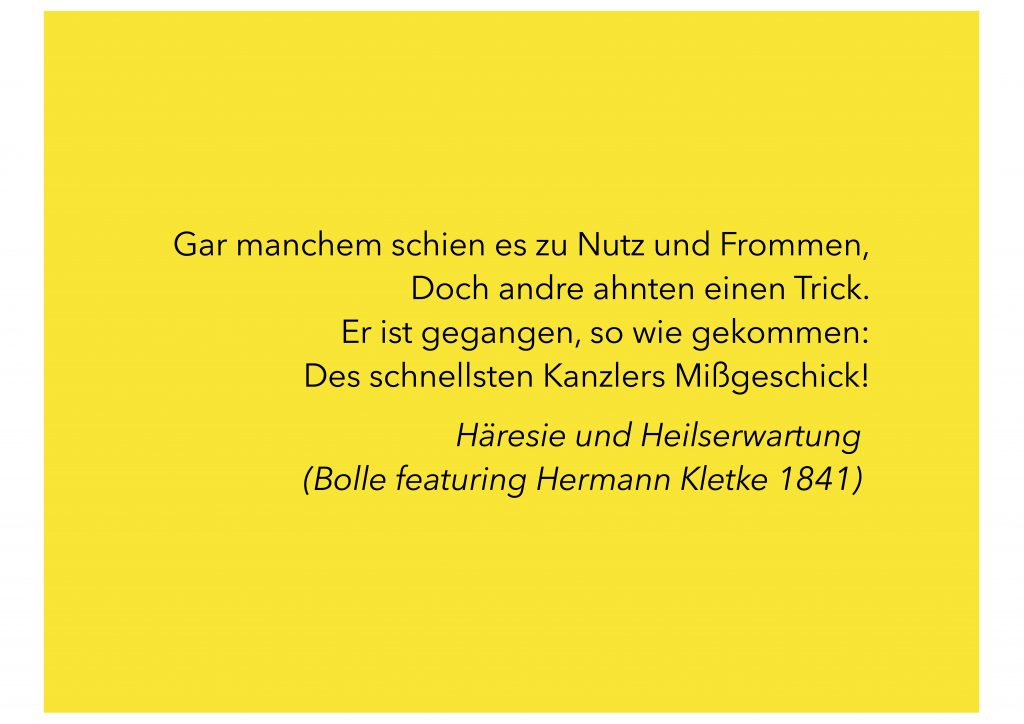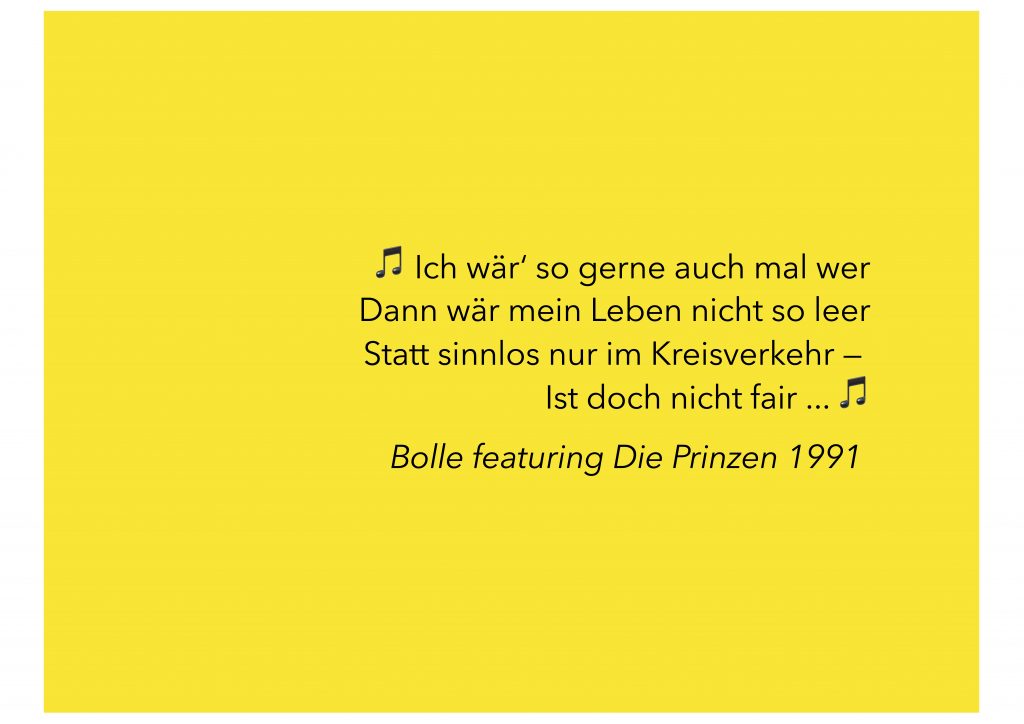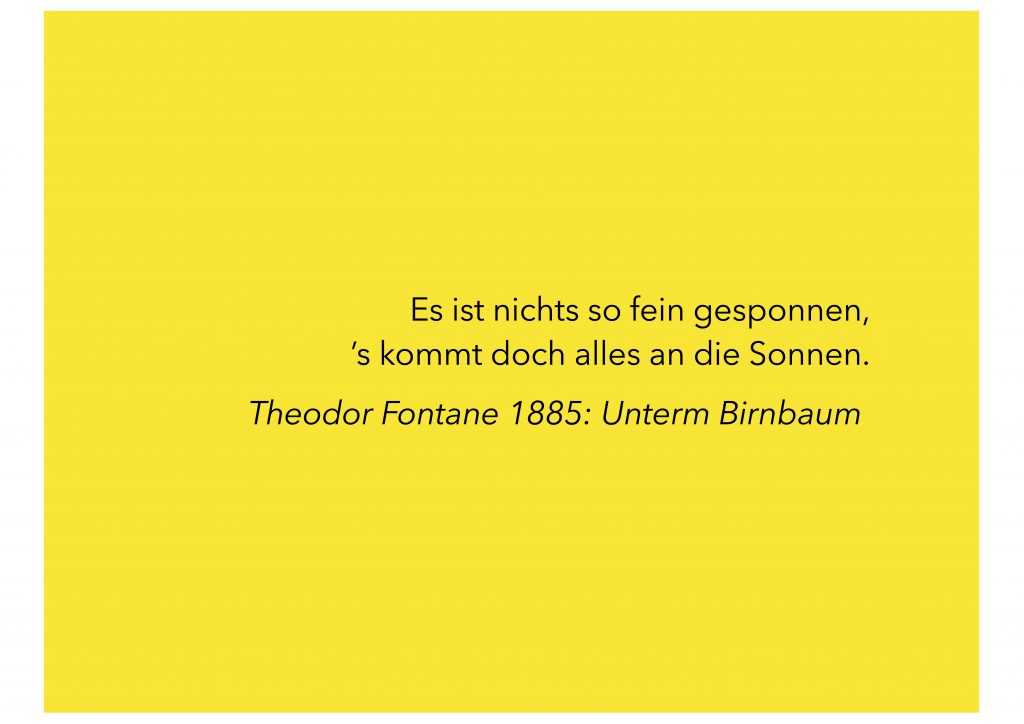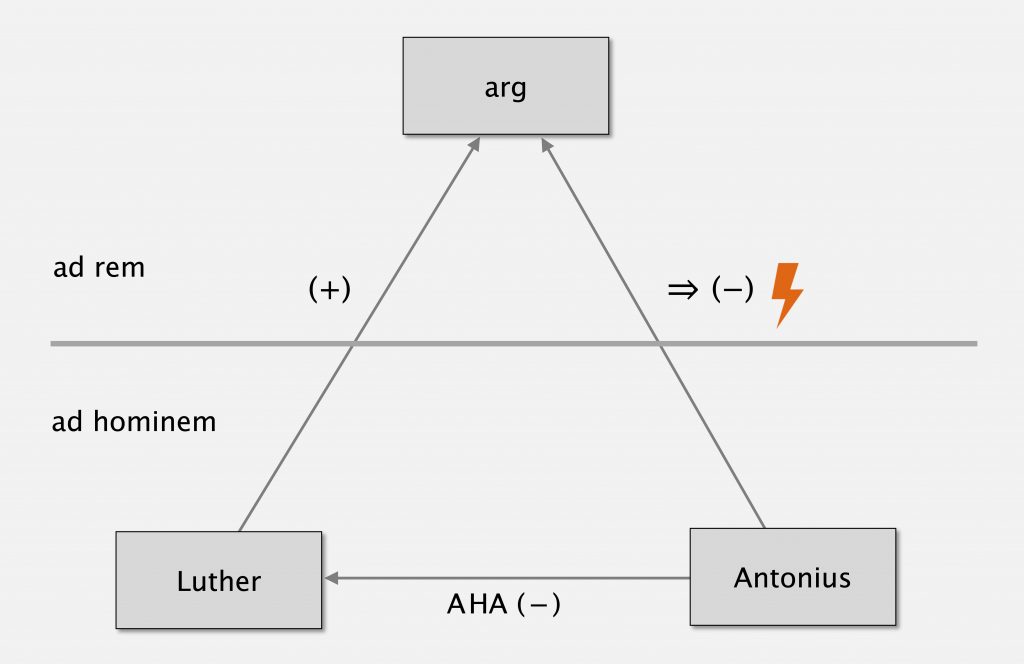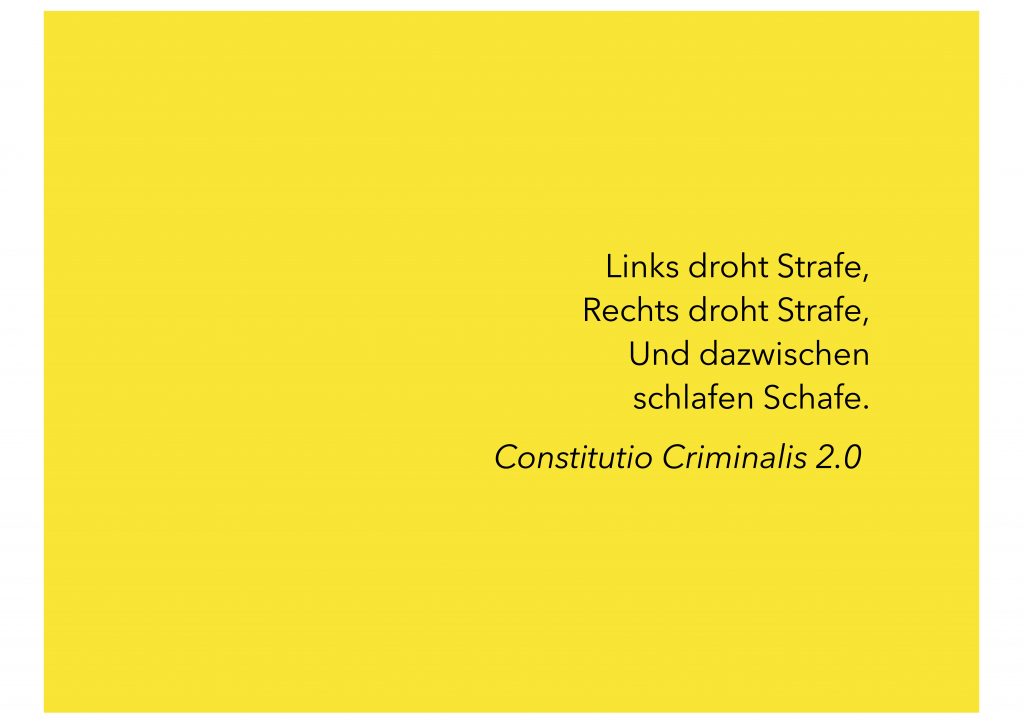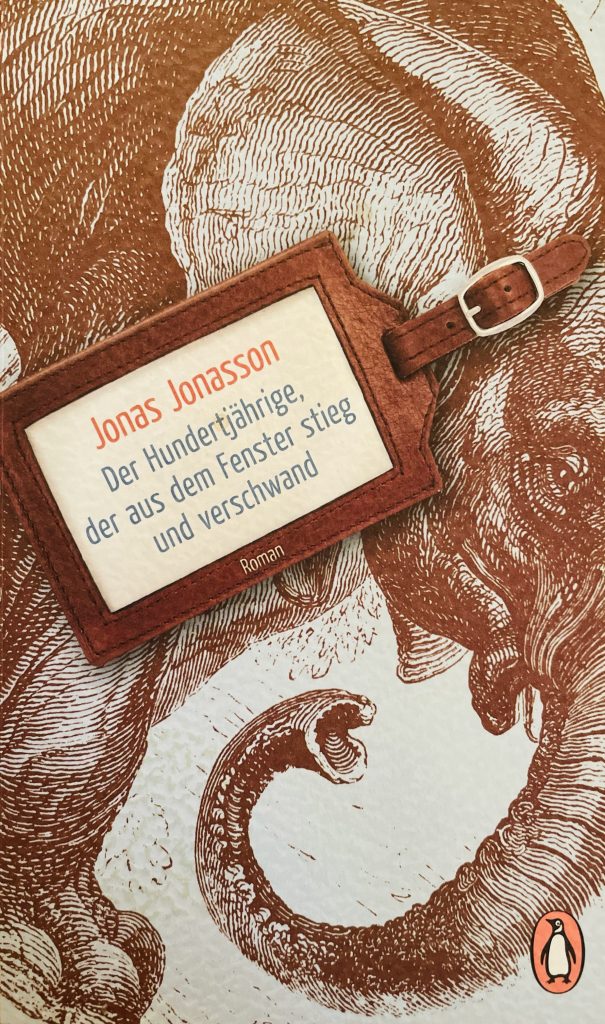
„Lieber Genosse Stalin“, hob Chruschtschow an. „Ich würde vorschlagen, daß das, was dort passiert ist, einfach nicht passiert ist. Ich würde vorschlagen, daß Wladiwostok sofort von der Umwelt abgeschlossen wird, daß wir die Stadt geduldig wiederaufbauen und sie zur Basis für unsere Pazifikflotte machen, genau wie Genosse Stalin es geplant hat. Doch das Wichtigste ist: Was dort passiert ist, ist nicht passiert. Alles andere würde eine Schwäche verraten, die zu verraten wir uns nicht leisten können.“
So liest es sich in Jonas Jonassons ›Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand‹ (2009). Die Szene muß sich am 4. März 1953 abgespielt haben – dem Vorabend von Stalins Tod. Allan Karlsson, der Held der Handlung, hatte – obwohl an sich äußerst genügsam – nach gut fünf Jahren sibirischen Lagerlebens das Schnäuzchen gestrichen voll, weil man, wie er meinte, da ja nicht mal irgendwo einen Schnaps bekäme. Und ein Schlückchen Schnaps gelegentlich – sei es Brännvin, sei es Wodka – wollte ihm durchaus nicht übertrieben dünken. So beschloß er, etwas zu unternehmen. Sein Plan sah vor – Allan war autodidaktischer Meister im Umgang mit Sprengstoffen aller Art bis hin zur Atombombe –, das Lagerleben ein wenig aufzumischen und das sich dabei hoffentlich ergebende Tohuwabohu zur Flucht zu nutzen. Zwar war der Plan nicht wirklich ausgereift – hatte aber, aufgrund einer Verkettung äußerst glücklicher Umstände, trotzdem prächtig funktioniert. Und so kam es, daß nicht nur der gesamte Gulag in Flammen aufging, sondern ganz Wladiwostok (wörtlich: ›beherrsche den Osten‹) gleich mit. — Das war aus Sicht der sowjetischen Führung natürlich sehr, sehr unschön. Allein, Genosse Chruschtschow wußte Rat. Und so kam es zu der oben geschilderten Szene.
Überhaupt kann Bolle sich des Eindruckes nicht erwehren, daß es den Herrschenden dieser Welt ein probates Mittel zu sein scheint, Unliebsames schlicht und ergreifend wegzulügen. In Diplomatenkreisen hat sich dafür übrigens ganz offiziell der Begriff ›dementieren‹ eingespielt – was (von franz. mentir ›lügen‹) wörtlich übersetzt nichts anderes bedeutet.
Dabei macht Dementieren aber vor allem dann und eigentlich nur dann Sinn, wenn man mit Fug und Recht erwarten kann, daß einem so schnell keiner auf die Schliche kommt – oder jedenfalls erst dann, wenn die Karawane längst weitergezogen ist. Kurzum: Chruschtschow und die Seinen konnten sich das leisten. Vielleicht war es sogar die klügste Option.
Sich aber – wie dieser Tage erst geschehen – in eine prominente Schnatterrunde (vulgo: Talkshow) zu setzen, dort von „Kontrolle“ (sprich: Zensur) beziehungsweise gar von einem Verbot unliebsamer Medien zu salbadern – um der verblüfften Öffentlichkeit hinterher dann zu erklären, daß das, was da passiert ist, gar nicht passiert sei –, das ist noch mal ganz was anderes. Mit der altehrwürdigen Kunst diplomatischen Dementierens hat das nicht mehr viel zu tun. Eher zeugt es – wie soll man sagen – von einem geradezu unerschütterlichen Urvertrauen in die Kraft des Konstruktivismus: Was lange währt, wird schließlich wahr. Man muß es nur oft genug und entschieden genug wiederholen. Oder, wie Simone Solga meinte: Die Phrase ist ihr eigener Beweis. Spötter behaupten gar, es fehle nicht mehr viel und demnächst werde es sogar heißen, man sei überhaupt nie in der Talkshow gewesen. Bei Stalin und Genossen wurde man schließlich auch gerne mal aus alten Photos einfach rausretuschiert. Bolle meint nur: Wegg is wegg!
Nun – jeder (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course), der’s gesehen hat, hat es nun einmal gesehen. Und wer’s nicht gesehen hat – oder meint, seinen eigenen Augen und Ohren nicht mehr trauen zu können: Wir haben Videobeweis! Das ist einer der Vorzüge des 21. Jahrhunderts. Man kann sich die einschlägige Szene wieder und wieder angucken – wobei man allerdings tunlichst auf die (auch nur knapp vier Minuten lange) ungeschnittene Version achten möge, of course. Sonst leidet die Wahrhaftigkeit doch sehr: Mit Schnittern ist gut Klittern – wie eine alte Journalistenweisheit weiß. Denken wir nur an Mr. Trumps angeblichen ›Sturm auf das Kapitol‹ seinerzeit, der sich, allerdings erst Jahre später, als rein medial mächtig multiplizierter BBC-„Schnittfehler“ herausgestellt hatte. Und wer’s dann immer noch nicht glauben mag: der möge halt selig werden mit seiner ganz speziellen mappa mundi. Ein Staat zu machen ist mit solchen Leuten dann wohl aber eher nicht.
Und? Was hätte Genosse Chruschtschow seinem Stalin unter diesen Umständen wohl geraten? Wir wissen es nicht. Obiges aber wohl sicher nicht. Genosse Chruschtschow war schließlich nicht dumm. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.