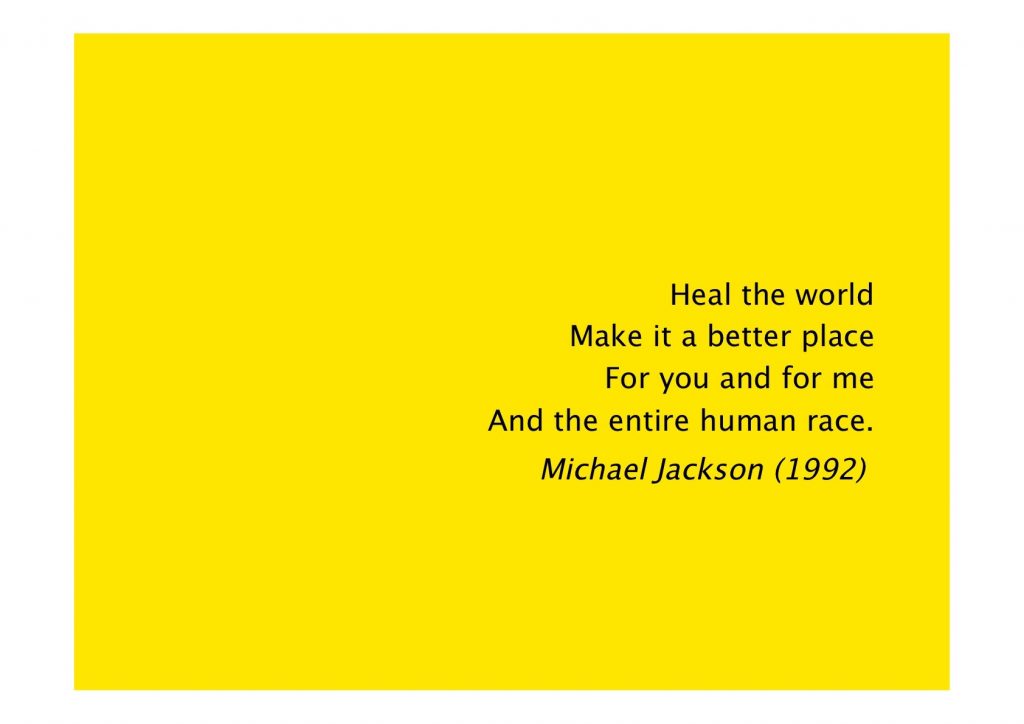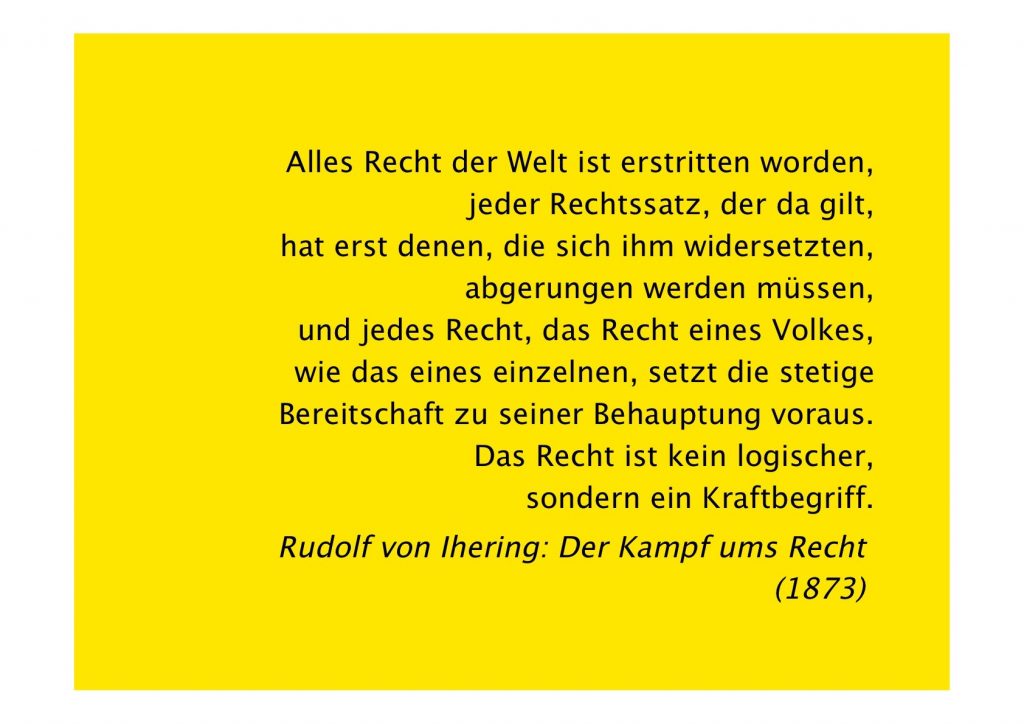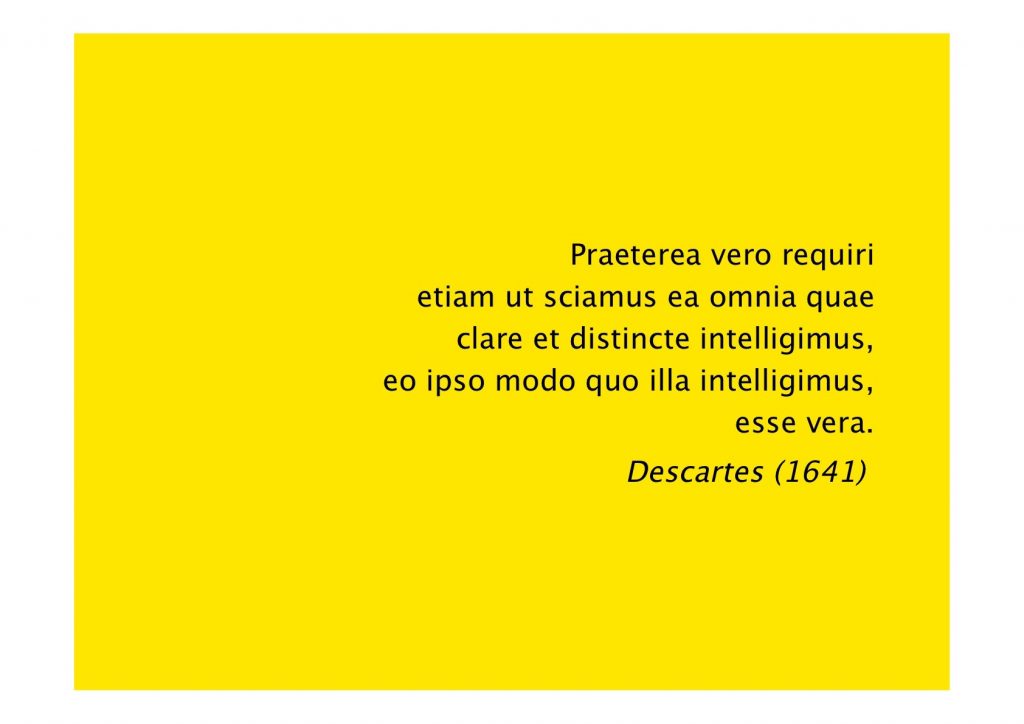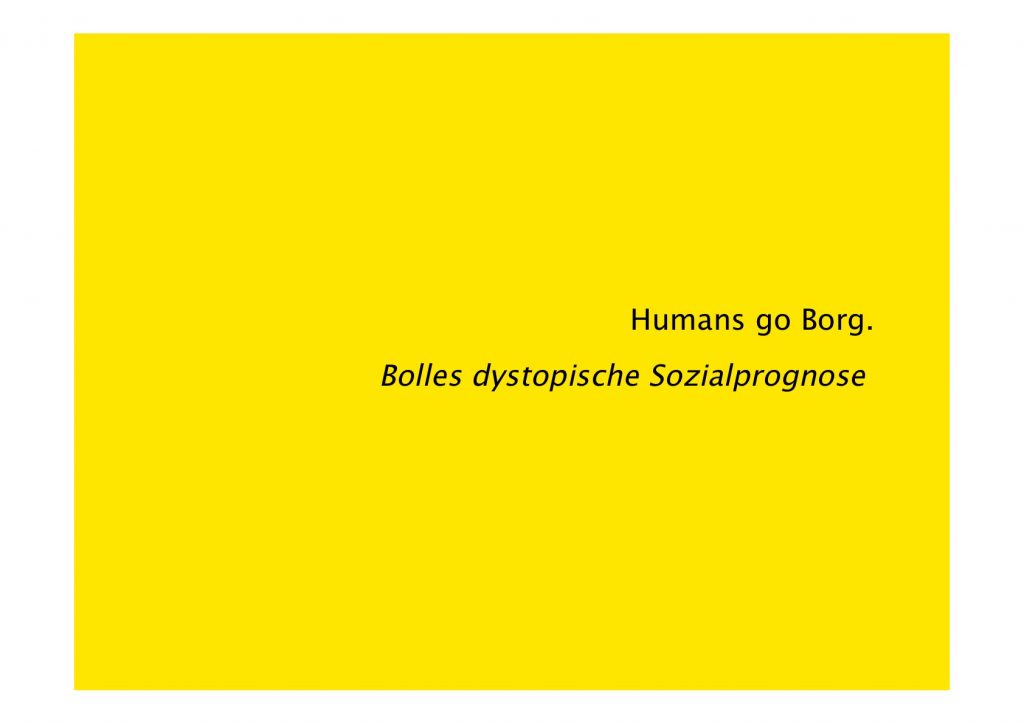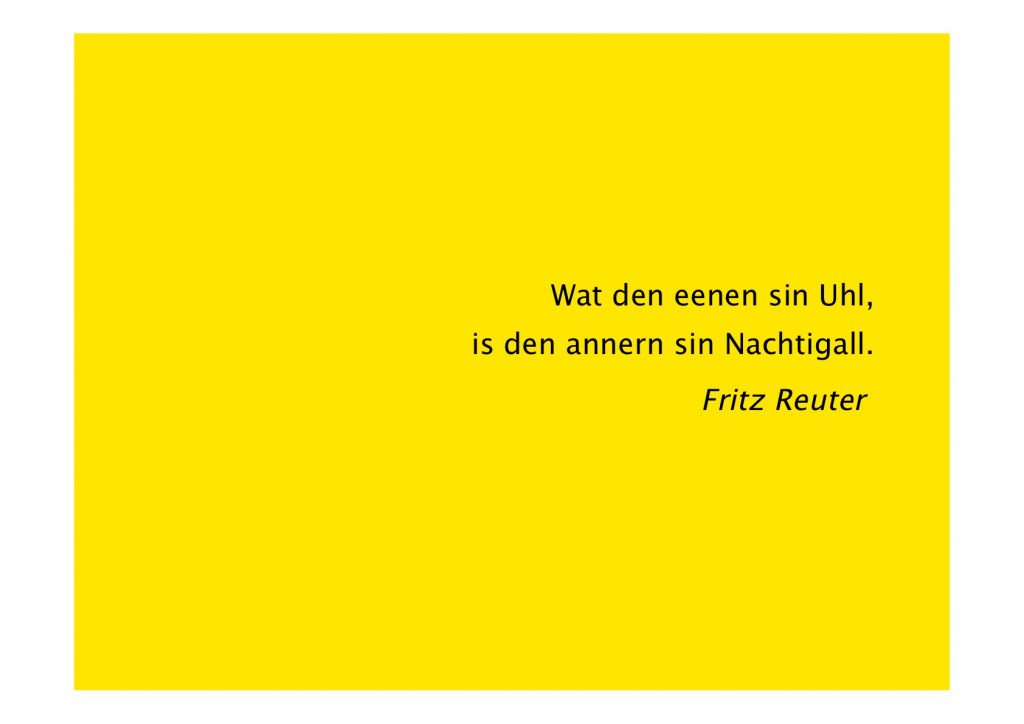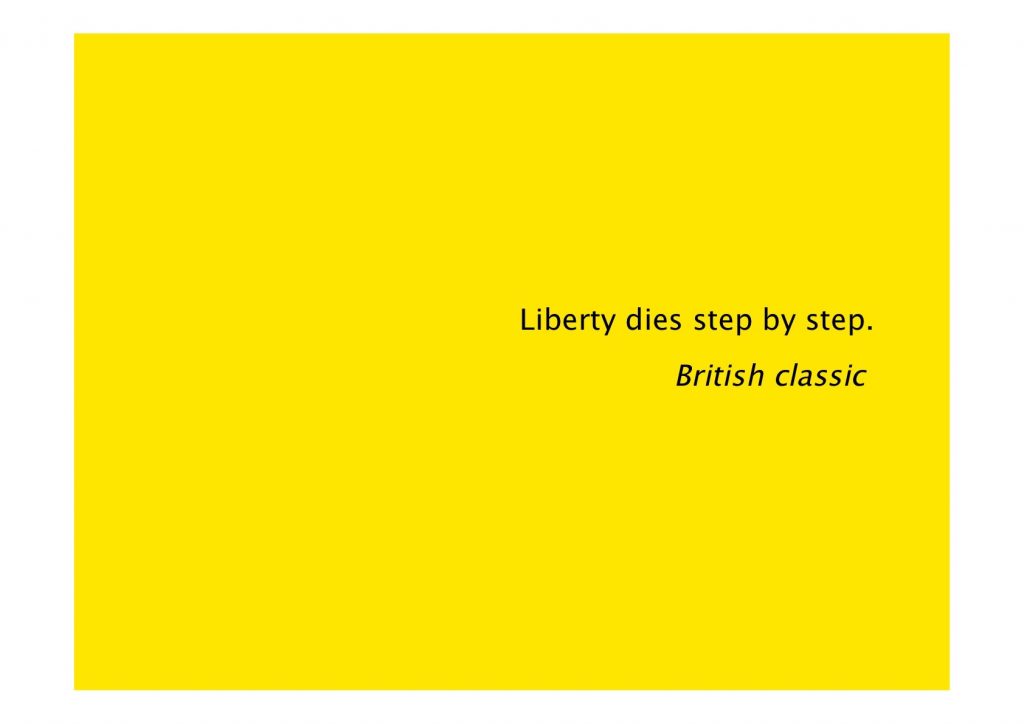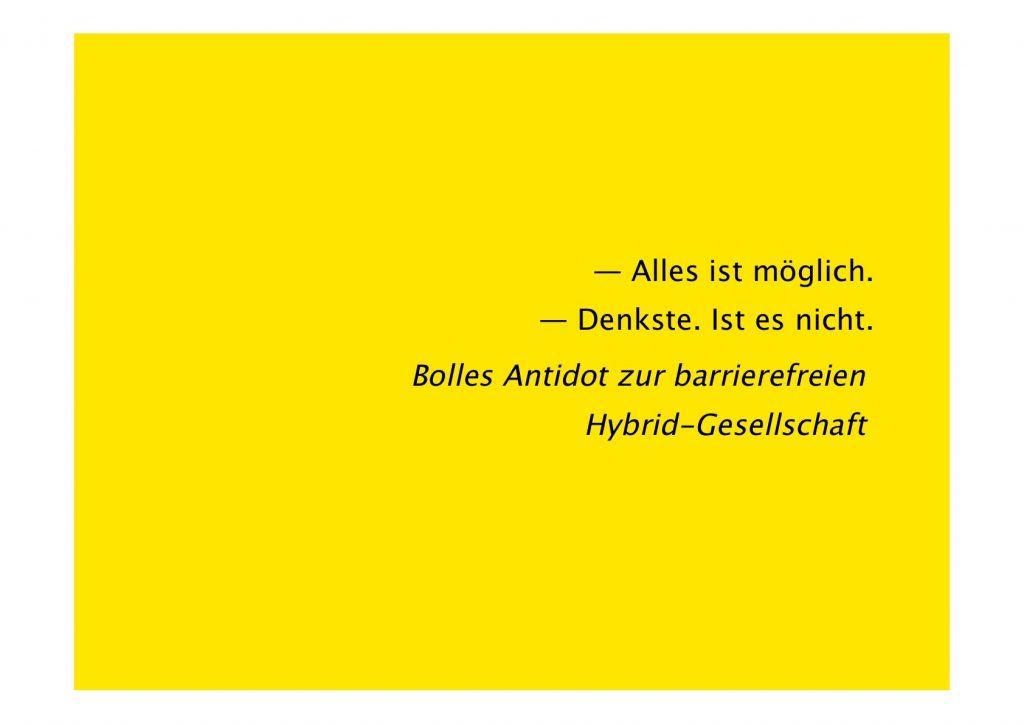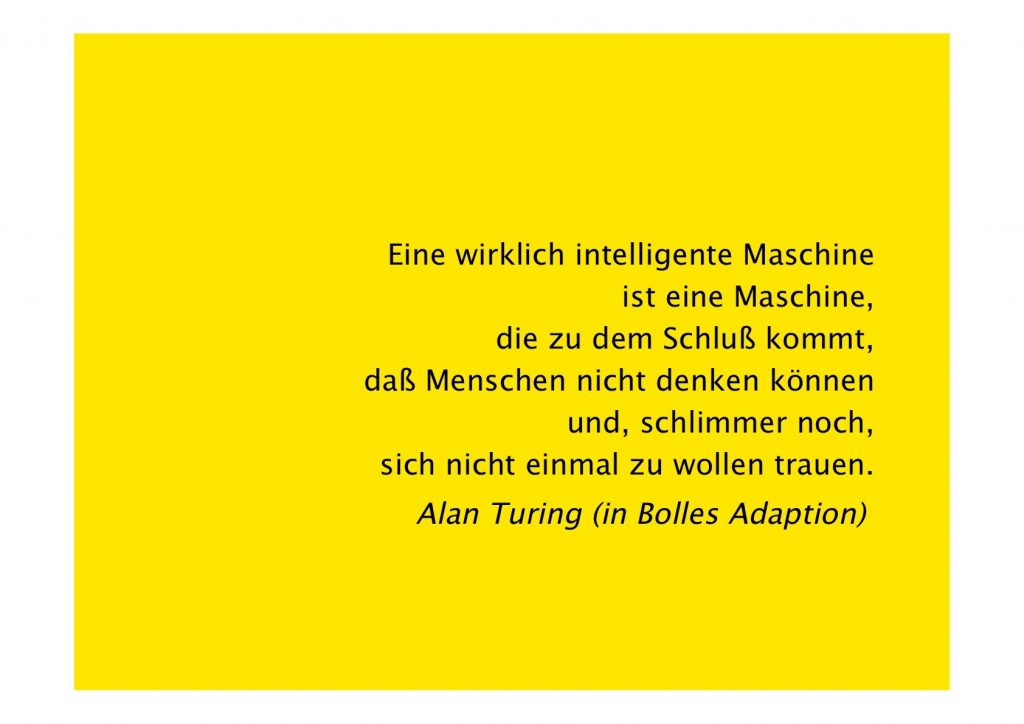
Die IT-Technologie hatte in den 1940er Jahren für damalige Verhältnisse gigantische Fortschritte gemacht. Weder der Bau der Atombombe noch die Entschlüsselung der ENIGMA wäre ohne „Maschinen“ – wie die Rechner damals noch hießen – möglich gewesen. Damit kam die Frage auf, was passieren müsse, um eine Maschine als „intelligent“ einstufen zu können bzw. gar zu müssen. So kam es 1950 schon zum (später) so genannten „Turing-Test“: Wenn ein Mensch sich über längere Zeit mit einer Maschine austauschen würde, ohne seinen „Gesprächspartner“ als Computer „entlarven“ zu können, dann müsse man – so Turing – davon ausgehen, daß die Maschine „intelligent“ sei. Der Clou dabei: Wir reden hier nicht von humanoider Intelligenz. Der konnten und wollten die frühen Nerds schon damals nicht allzu viel zutrauen. Falls Ihr Zweifel habt: Fragt Euch doch mal kurz, was die dritte Wurzel aus 4711 ist? Und dann fragt mal Euren Taschenrechner. Die Antwort ist etwa 16,76374. Und? Wer war schneller? Oder zählt mal kurz durch, wie oft der göttliche Zuspruch „Fürchte Dich nicht“ in der Bibel vorkommt. Eine Maschine erledigt so etwas in sekundenschnelle. Oder versucht mal, einen modernen Schachcomputer zu schlagen. Fassen wir zusammen: Maschinen ticken anders – und können dabei sehr, sehr vieles sehr viel besser als humanoide Intelligenz das jemals können wird. Damit stellt sich früher oder später – nach heutigem Stand eher früher – die Frage: Wer hat auf Dauer das Sagen? Maschinen oder Menschen? Diese und ähnliche Überlegungen veranlaßten Turing damals schon zu der verschärften Fassung – daß also Maschinen auf die Idee kommen könnten, daß Menschen letztlich gar nicht denken können.
Und? Was sagt Bolle? Schlimmer geht immer. Wir hatten diesen Punkt am Rande schon mal kurz gestreift – vgl. dazu Fr 04-12-20 Das vierte Türchen … Bei ›Alice in Wonderland‹ heißt es ganz treffend:
– Könntest Du mir bitte sagen,
wie ich von hier aus am besten weiterkomme?
– Das hängt schwer davon ab, wo Du hin willst …
Kurzum: Solange man nicht weiß, wo man hin will, muß man sich nicht wundern, wo man ankommt – falls überhaupt irgendwo. Können die Maschinen das nicht für uns ausrechnen? Nein, können sie nicht. Wo wir hinwollen, müssen wir schon selber wissen. Und wenn wir uns nicht trauen zu wollen, sieht’s finster aus – furchtbar finster. Übertrieben? I wo. Hier ein einziges, klitzekleines Beispiel aus den heutigen Nachrichten: Wir wollen (1) „Freie Grenzen in Europa“ und wir wollen (2) „Die Pandemie eindämmen“. Ja, was denn nun? Idealerweise beides – und zwar gleichzeitig. Das funktioniert aber absehbar nicht.
Eine Maschine würde kühl zwei Eingaben erwarten:
Was sind die Zielparameter (was wollt Ihr erreichen)?
Was sind die Aktionsparameter (an welchen Stellschrauben ließe sich drehen)?
Und wenn wir dann bei Zielparameter „Friede, Freude, Eierkuchen“ nebst „Demokratie und Freiheit“ und vielleicht auch noch „heal the world“ eingeben, dann wird jede Maschine – und sei es die intelligenteste – ein fröhliches „Error“ ausspucken: Gleichungssystem nicht lösbar. Ein humanoides soziales System – insbesondere eine Demokratie – braucht da deutlich länger, um zum gleichen Ergebnis zu gelangen. Das indes geht absehbar so lange so weiter, bis die Maschinen dann letztlich doch zu dem Ergebnis kommen, daß Menschen in der Tat nicht denken können – und nicht einmal zu wollen wissen. Aber das ist dann wirklich doch schon wieder ein anderes Kapitel.