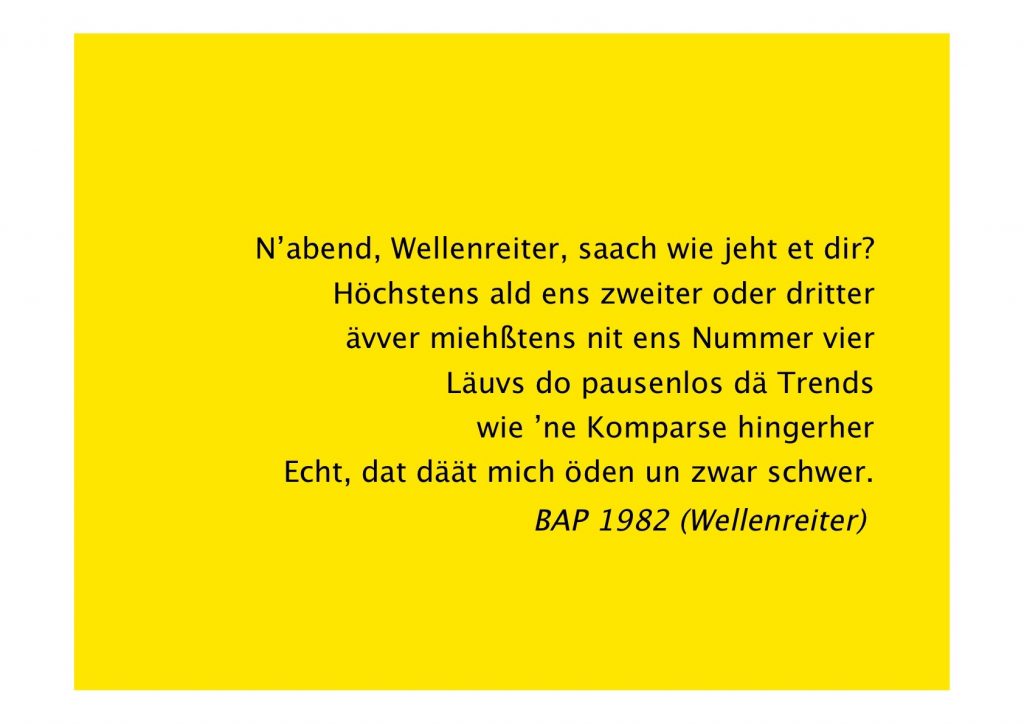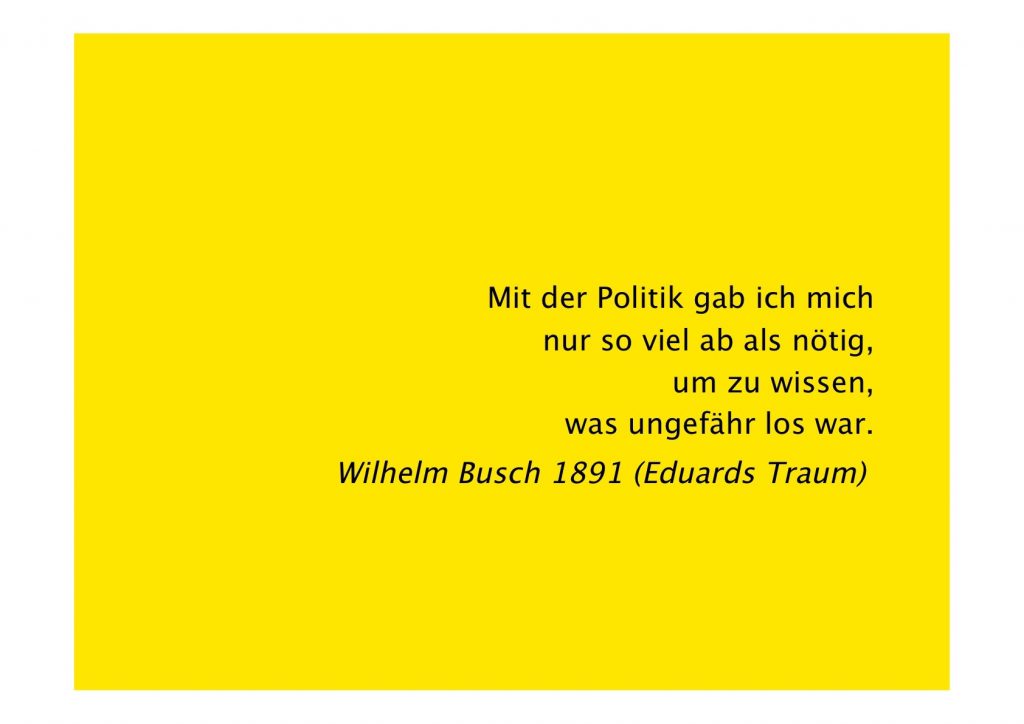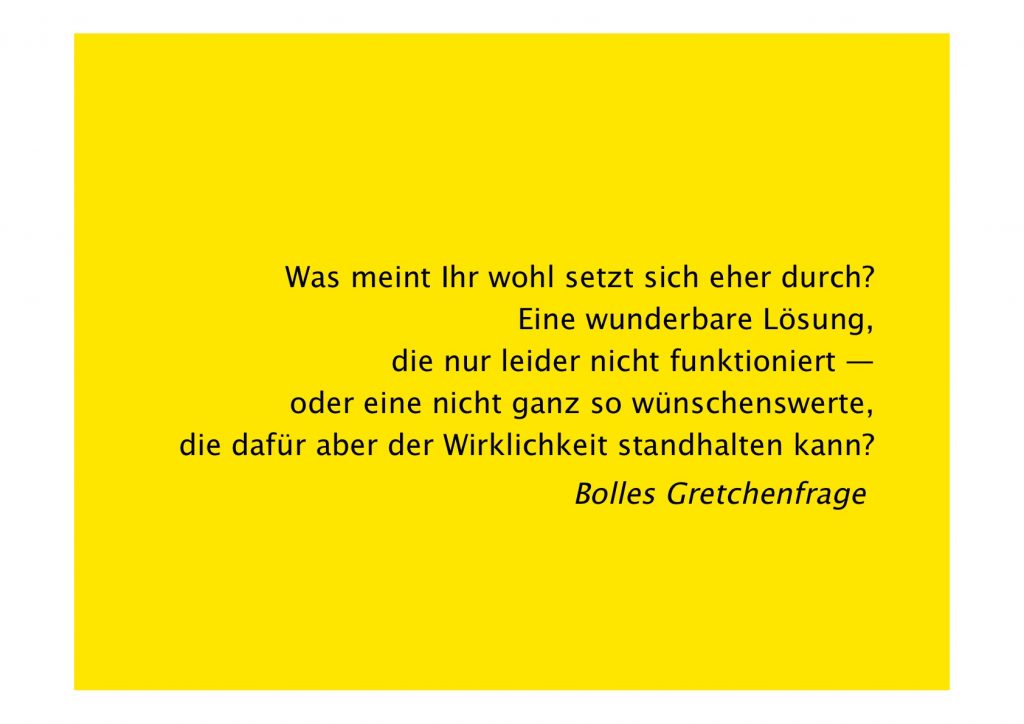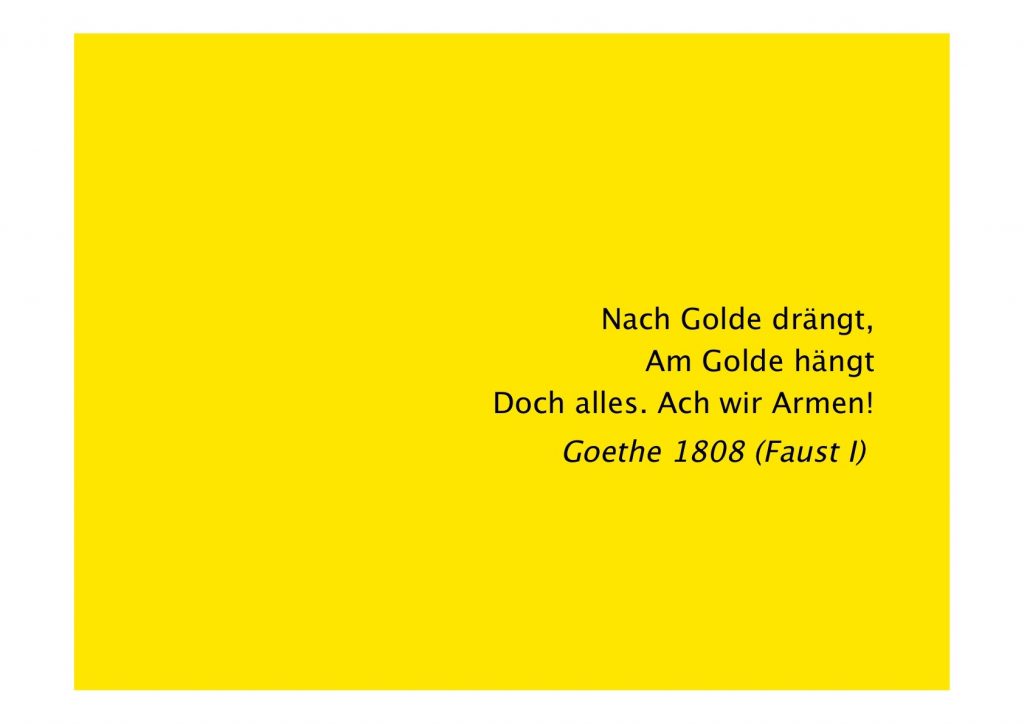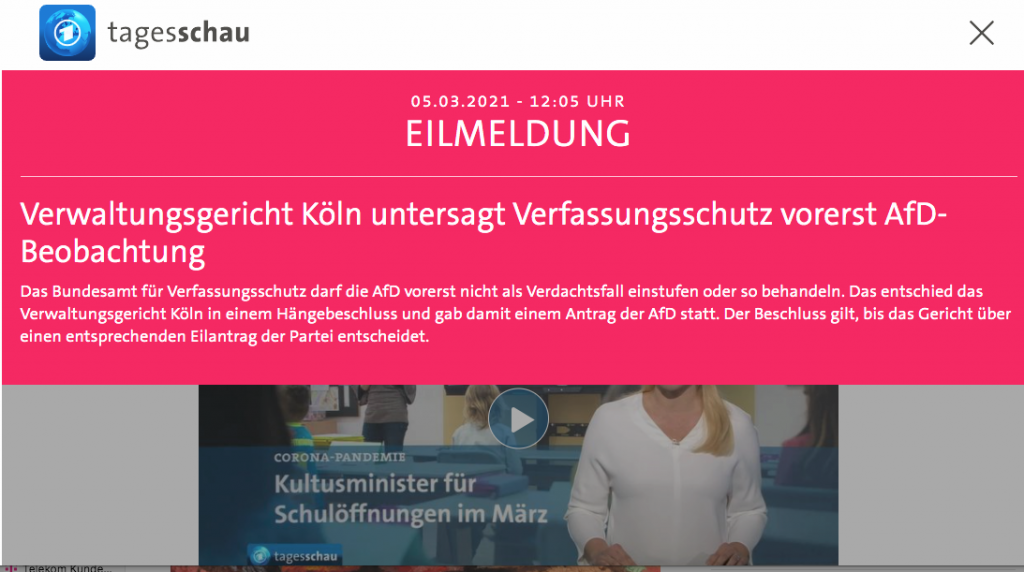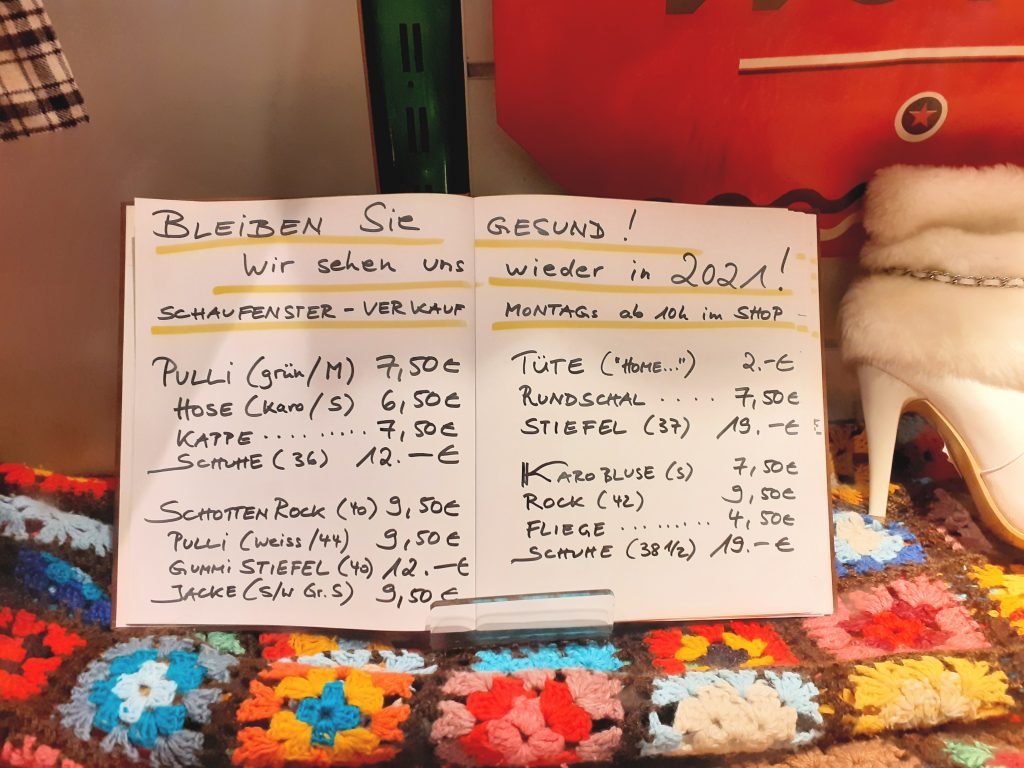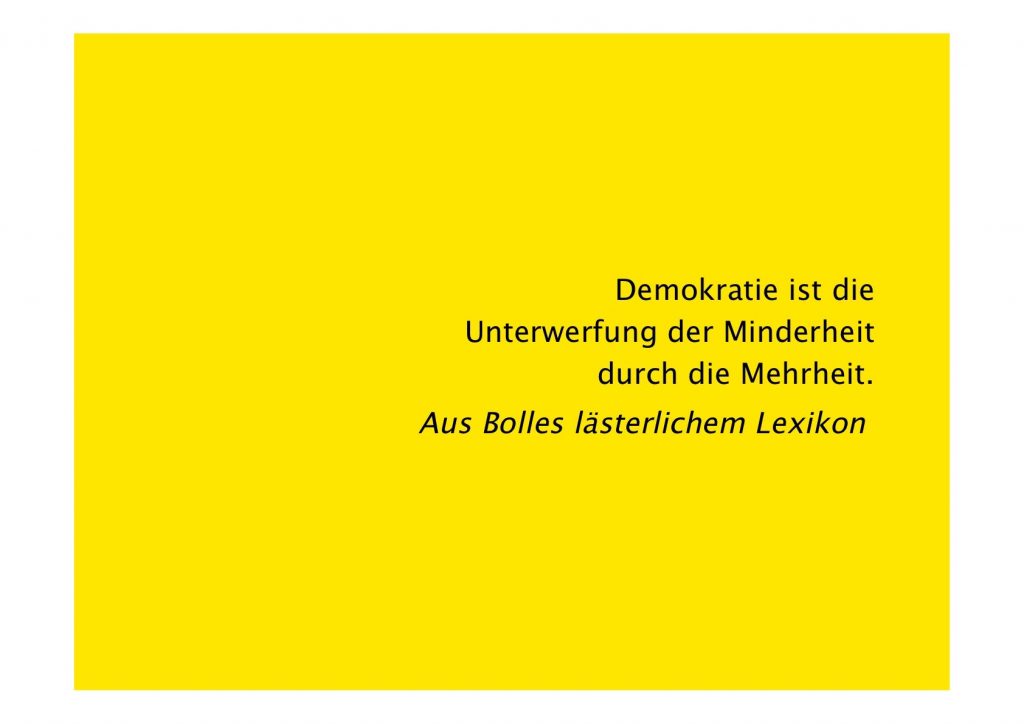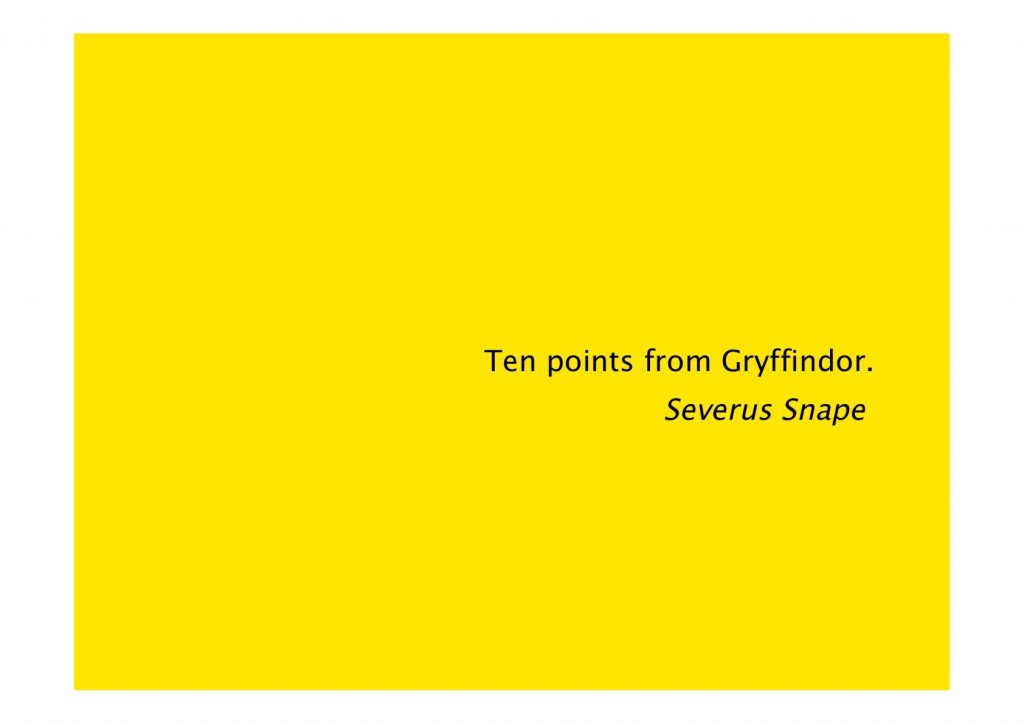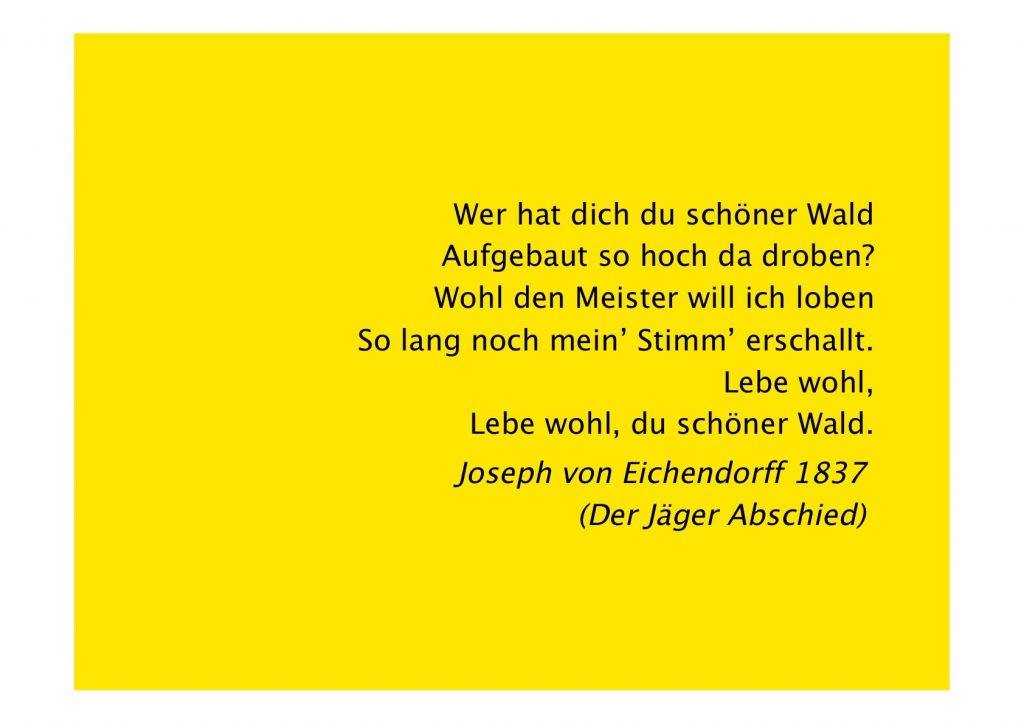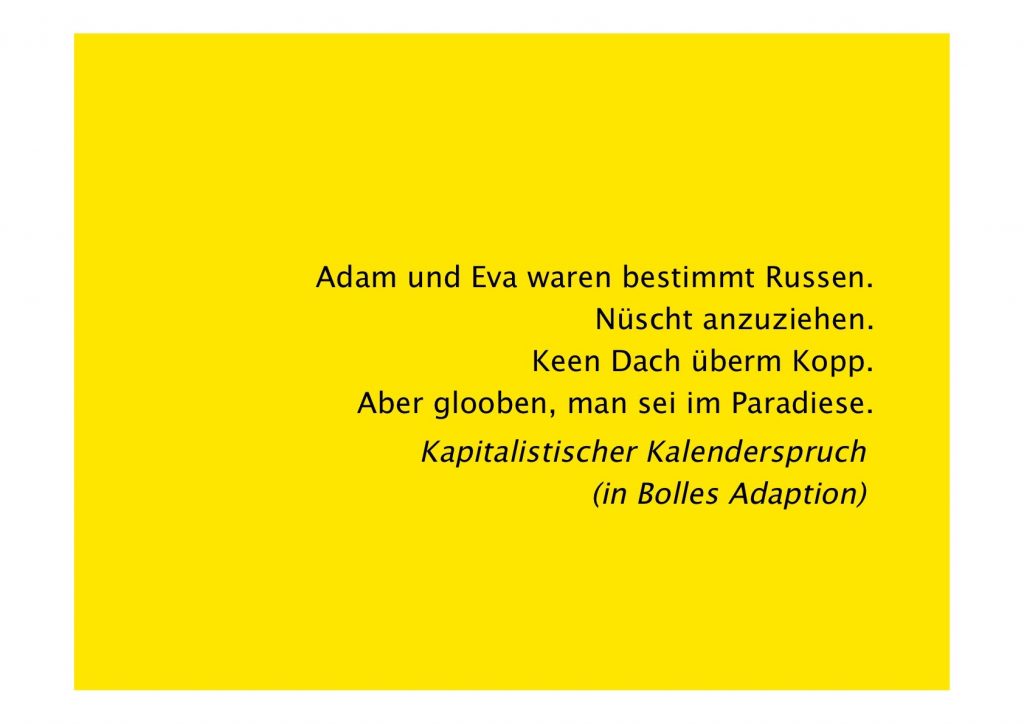
Damals, 1957, war der Teufel los. Nur 12 Jahre nach dem Endsieg über Nazideutschland und mitten im damals so genannten Kalten Krieg hatten sich die Russen erfrecht, ein Flugobjekt in den Weltraum zu schießen und damit ein Leuchtfeuer technischer Kompetenz gezündet. Im freien Westen war seinerzeit allen Ernstes von „Sputnik-Schock“ die Rede. Die Russen: Nüscht anzuziehen, keen Dach überm Kopp – aber sich im Weltraum tummeln.
Zwar meinte Bolle damals schon, ein Begriff wie »Weltraum« sei ja wohl doch ein wenig sehr euphemistisch, wenn man sich die Proportionen auch nur grob vor Augen hält: Von der Erde bis zu einer Umlaufbahn braucht ein Lichtstrahl in etwa eine zehntel Sekunde. Bis zu unserer Sonne sind es immerhin schon gut 8 Minuten, und bis zu den Außenbereichen unseres Planetensystems, dem Kuipergürtel, fast 7 Stunden. Nun ist eine zehntel Sekunde im Vergleich zu 7 Stunden doch eher wenig. Mikro-Peanuts, sozusagen. Doch es kommt noch dicker: Bis zur nächsten Sonne um die Ecke, Proxima Centauri, würde unser Lichtstrahl schon über 4 Jahre brauchen. Soviel zum Thema »Weltraum«. Das allerdings hat damals keinen interessiert – und tut es wohl bis heute nicht.
Aber davon ab: Der Sputnik-Schock saß tief. So tief, daß der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, unbedingt bemannt zum Mond fliegen wollte, und zwar rucki-zucki, binnen eines einzigen Jahrzehntes – einfach nur um klarzustellen, wer hier Master of the Universe ist.
Und dann das mit den Atomkraftwerken. Als den Russen 1986 ihr Tschernobyl um die Ohren geflogen war, da hieß es im freien und fortschrittlichen Westen: Keen Wunder – sind halt Russen. Dumm gelaufen, war aber absehbar. Uns kann so was nicht passieren. Wir können schließlich Mond.
Erst als den Japanern, genau heute vor 10 Jahren, in Fukushima genau das gleiche passiert war, begann im Westen das große Flattern – allen voran bei den Deutschen: Ausstieg aus der Atomenergie sprichwörtlich über Nacht. Gerade erst beschlossene Laufzeitverlängerungen wurden, von einer Physikerin übrigens, über Nacht suspendiert – whatever it takes.
Und jetzt erfrechen sich die Russen, in Rekordzeit einen Impfstoff zu entwickeln, der anscheinend tadellos funktioniert – und allen Ernstes auch noch ›Sputnik‹ heißt. Zufall? Sprach-Design? Treppenwitz der Geschichte? Wir wissen es nicht.
Und? Was macht der Journalismus 2.0? Wundert sich, daß einige Länder der EU – einschließlich Thüringen übrigens – lieber Sputnik „verimpfen“ als gar nicht impfen. Berichtet, daß kein Land der EU häufiger von „Falschinformationen“ aus Rußland betroffen sei als Deutschland – und führt das auf ein hierzulande unzureichendes Maß an Vorurteilen zurück. Zeigt sich befremdet, daß eine AfD-Delegation dieser Tage nach Rußland reist, um im Gespräch zu bleiben. Miteinander reden – das geht ja wohl gar nicht. Fragt sich, warum denn North Stream 2, fünf Minuten vor Fertigstellung, nicht doch lieber wieder eingestampft wird, um den Weg freizumachen für amerikanisches Fracking-Gas. Das ist zwar deutlich teurer und auch sehr viel umweltschädlicher. Dafür kommt es aber aus einem freien Land – und das ist ja wohl die Hauptsache für lupenreine Demokraten (vgl. dazu auch Fr 04-09-20 Die Recken des Rechtsstaates).
Kurzum: Die Rußland-„Skepsis“ (wie das neudeutsch neuerdings heißt) sitzt so richtig, richtig tief bei den „Eliten“ im Lande. Das scheint Bolle aber eher sozialpsychologisch bedingt und weniger geschichtlich. Die letzte ernstliche russische Invasion nach Europa liegt mittlerweile immerhin zwei- bis dreihundert Jahre zurück. Damals waren russische Adelige in Scharen in Pariser Cafés und Salons eingefallen, weil sie sich zuhause, zwischen Tundra und Taiga, einfach zu sehr gelangweilt hatten. Das aber ist dann doch schon wieder ein anderes Kapitel.