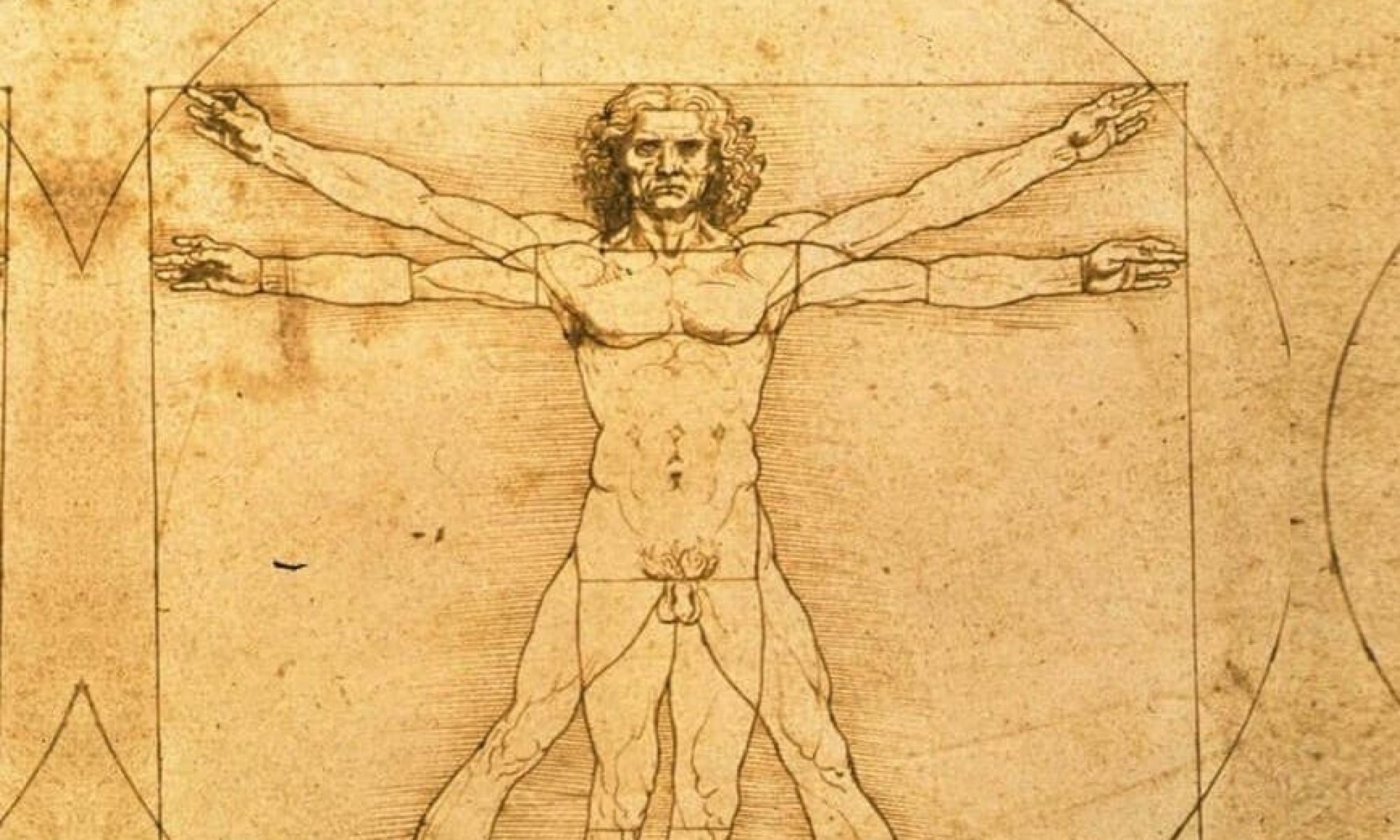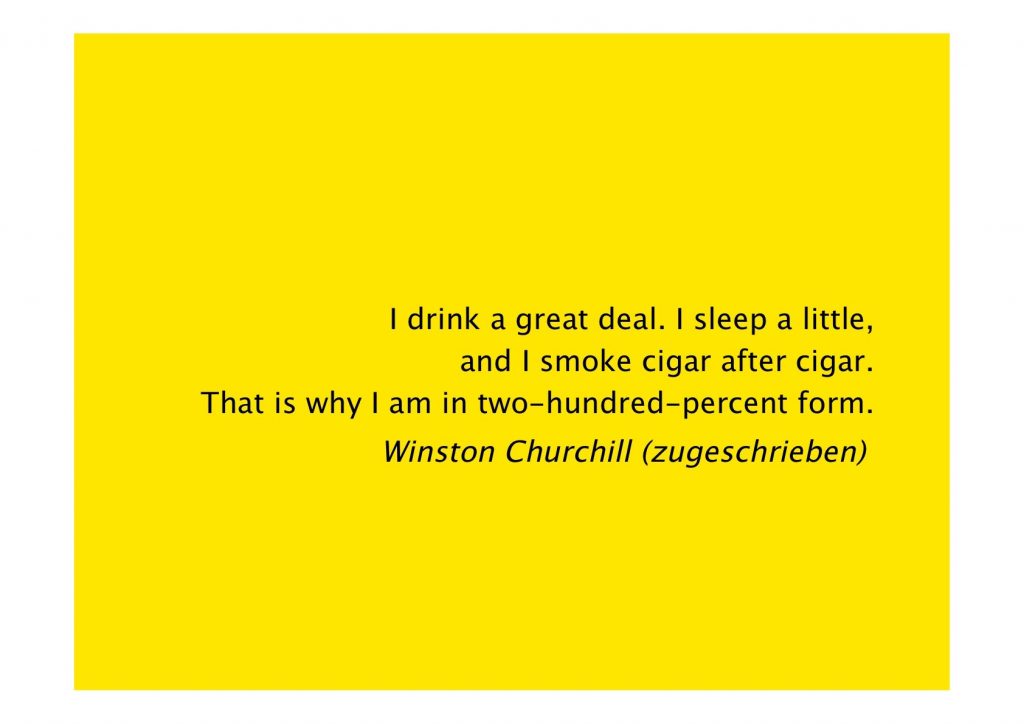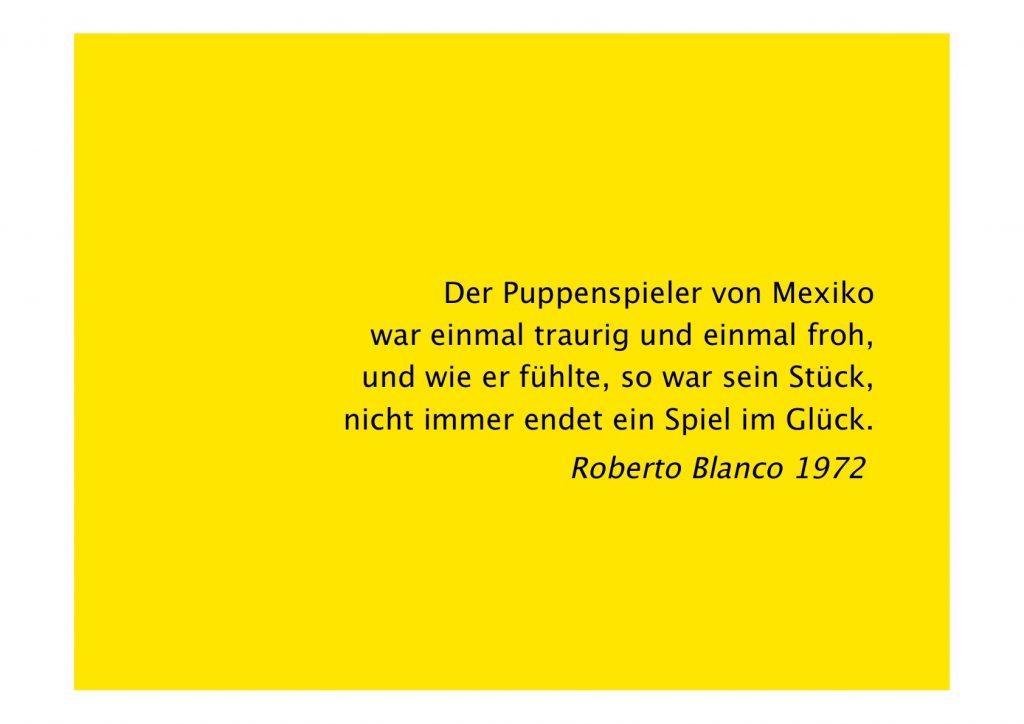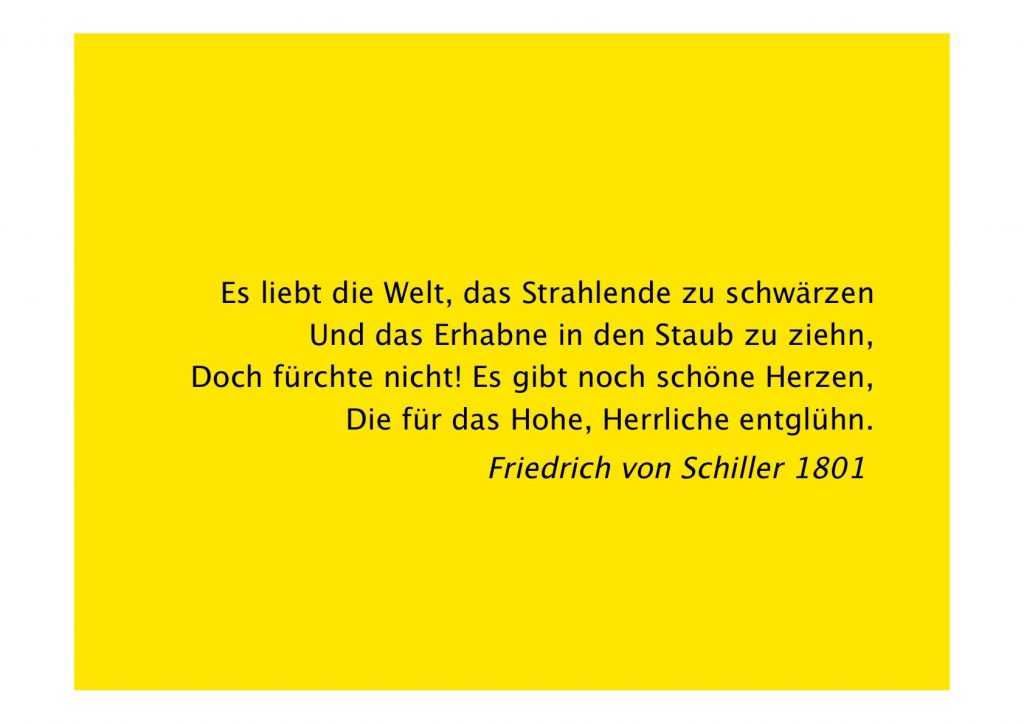Der Sinnspruch heute stammt in der Tat aus Shakespeare’s Hamlet – das war Bolle durchaus nicht klar – und ist damit auch schon wieder 400 Jahre alt. Höchste Zeit, sich dran zu halten. Oft genug passiert aber glatt das Gegenteil. So hat sich zum Beispiel, Ironie pur, ein deutscher Aphoristiker bemüßigt gesehen, da einen Sechszeiler draus zu machen. Aber das soll hier nicht unser Thema sein. Was dann?
Bolle hat sich schon öfters mal gefragt, wie es sein kann, daß jeden Tag genau so viel passiert, daß es exakt die Seiten einer Zeitung füllt oder auch das vorgegebene Zeitfenster etwa der Abendnachrichten. Irgendwas kann da nicht stimmen. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Trick – wie es ›Wir sind Helden‹ in ihrem Lied ›Geht auseinander‹ 2005 schon recht trefflich (und fast wörtlich so) gefaßt haben. Und? Wie geht Bolles Trick?
Im Grunde ist der Trick, wie die meisten guten Ideen, so simpel, daß Bolle sich im Nachhinein gefragt hat, wieso er da nicht sehr viel früher schon drauf gekommen ist. Zeitung lesen scheidet seit langem aus, weil es da ja offenkundig weniger um Nachrichten an sich geht als um journalistische Selbstverwirklichung. Im übrigen ist Bolle der Zeitverzug zwischen Ereignis und Übermittlung zu groß. Und was die bildungsbürgerlichen Nachrichtensendungen angeht – die Bolle wenigstens kursorisch zur Kenntnis nehmen will: Die lassen sich, zumindest im Internet, im Fast forward-Modus goutieren. So bietet etwa die ARD ihre jeweils letzte Nachrichtensendung unter ›tagesschau.de/sendung/letzte-sendung/‹ als Video-Stream an – mit dem unschätzbaren Vorteil, daß man die ganzen Propaganda-Einlagen und sonstigen Banalitäten bequem via Pfeiltaste überspringen kann. Fast forward, eben. Eine durchschnittliche Sendung von etwa 15 Minuten schafft Bolle so locker in 2 bis 3 Minuten – wenn überhaupt. Wenn das kein Fortschritt ist. Außerdem befreit einen das von der Bindung an alberne Sendezeiten. Aber das ist dann doch schon wieder ein anderes Kapitel.