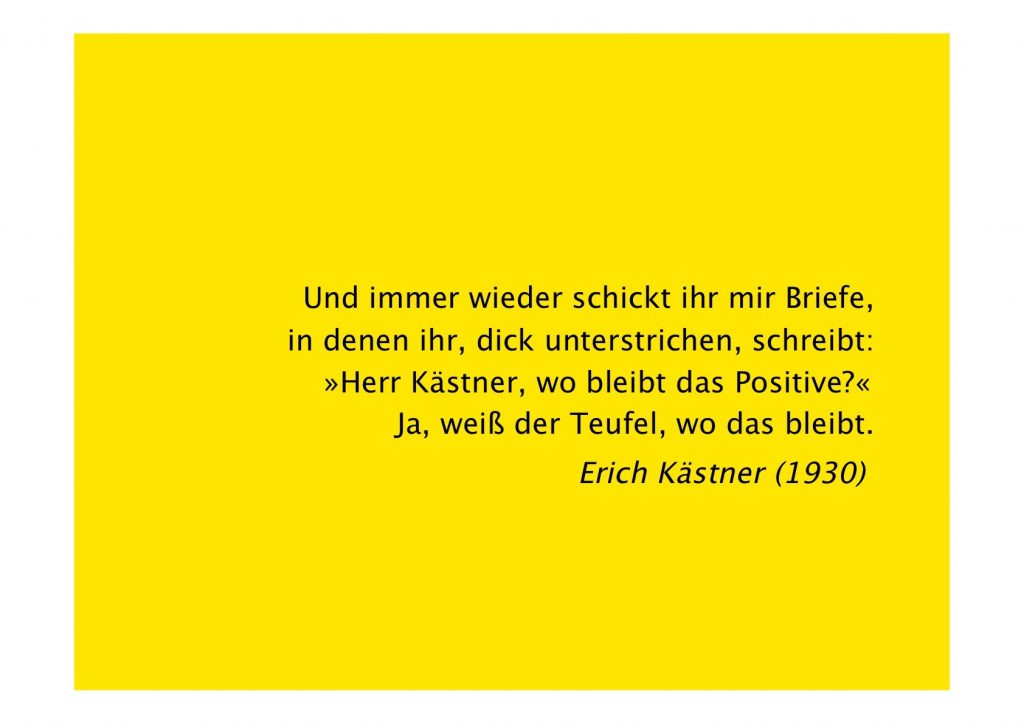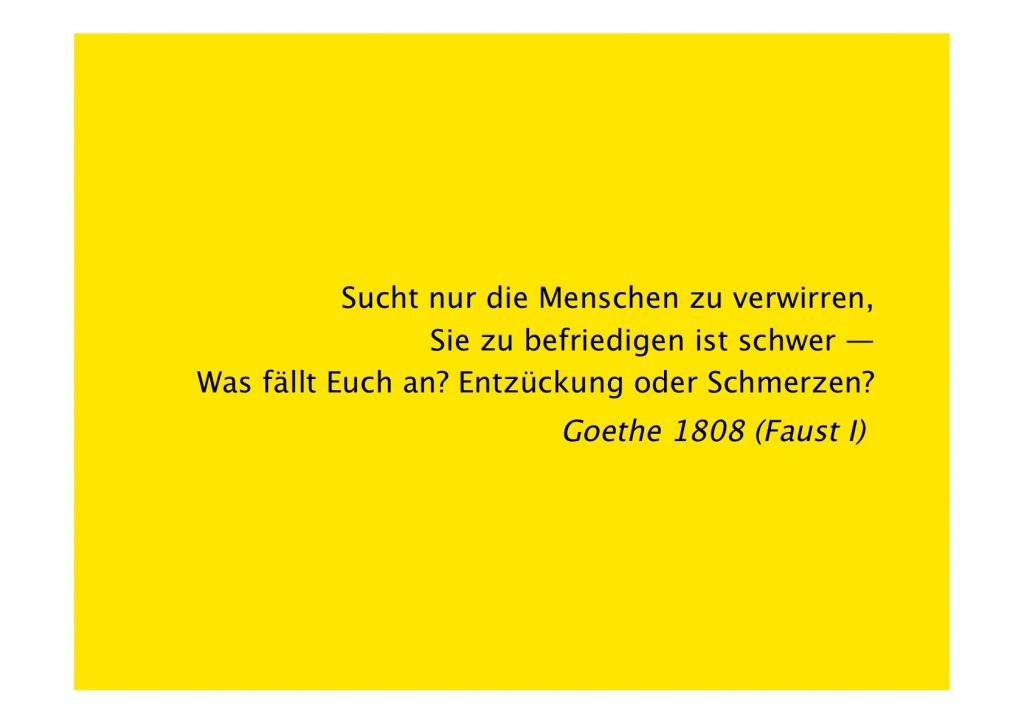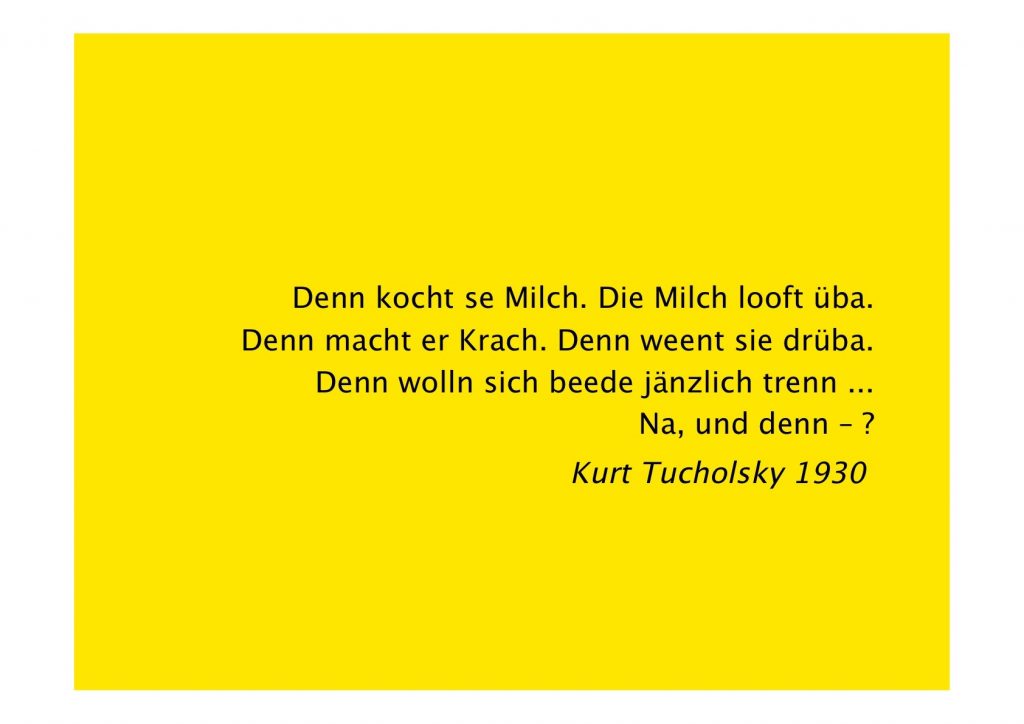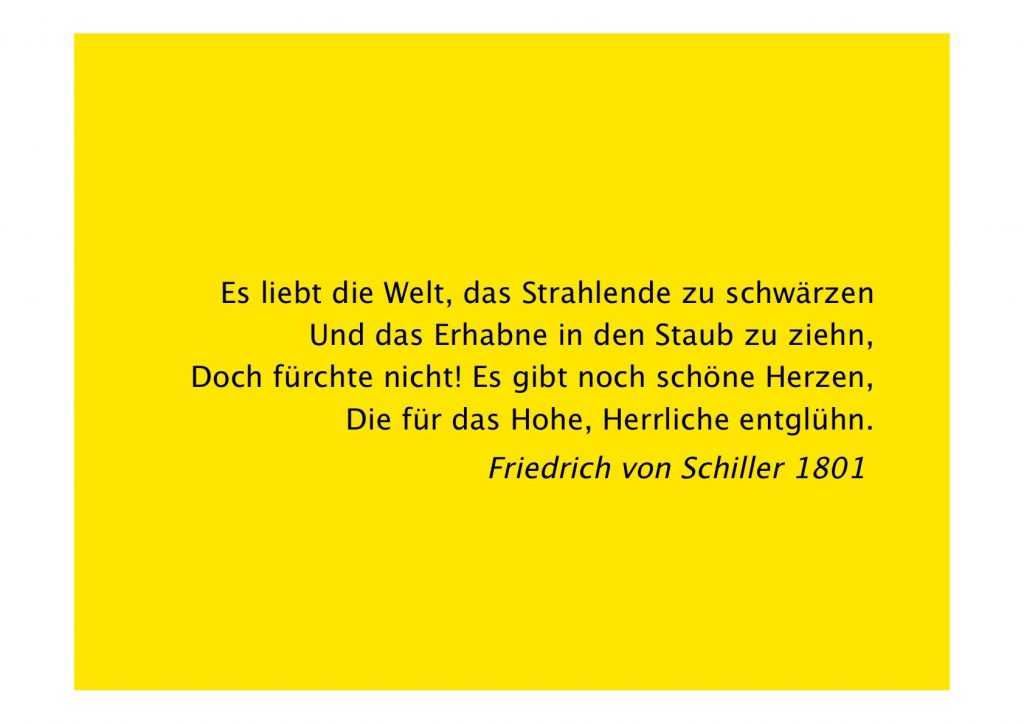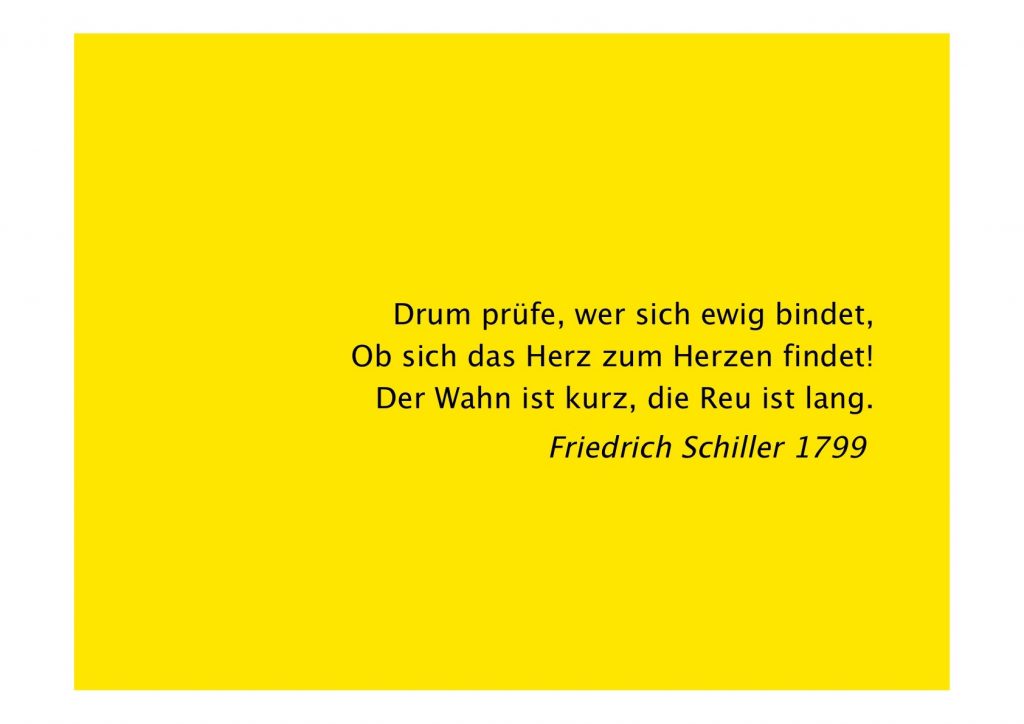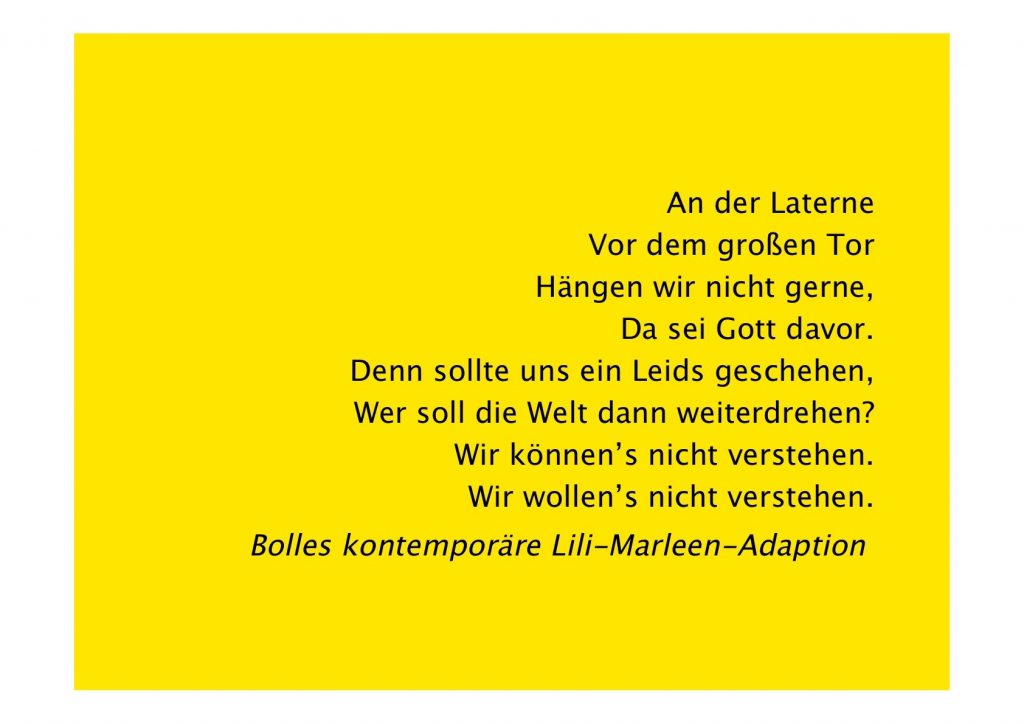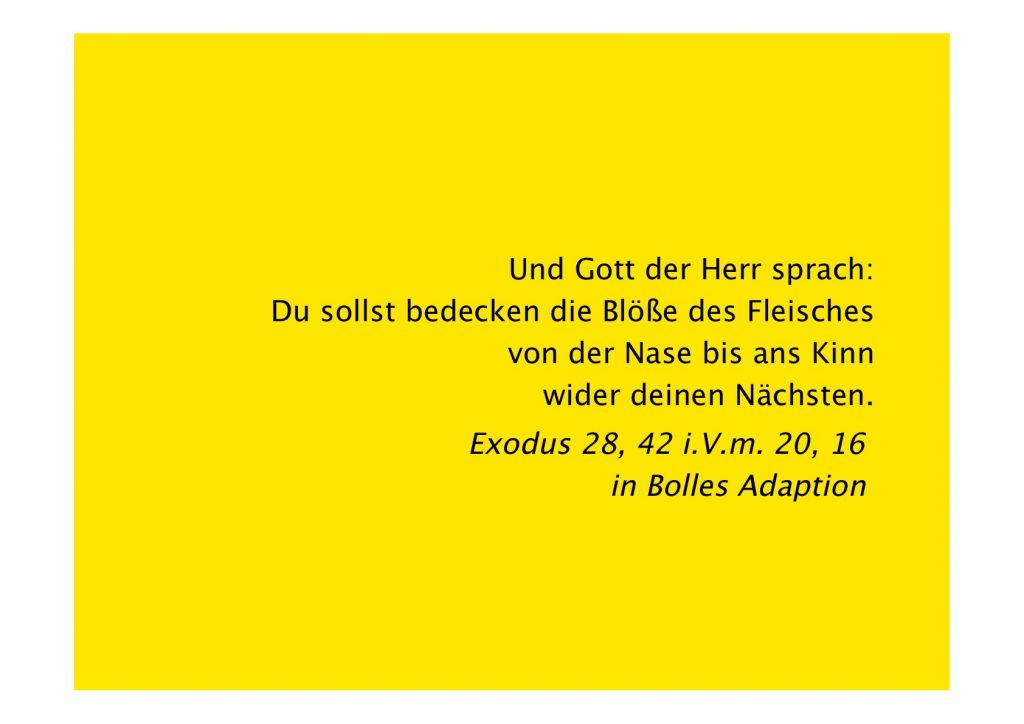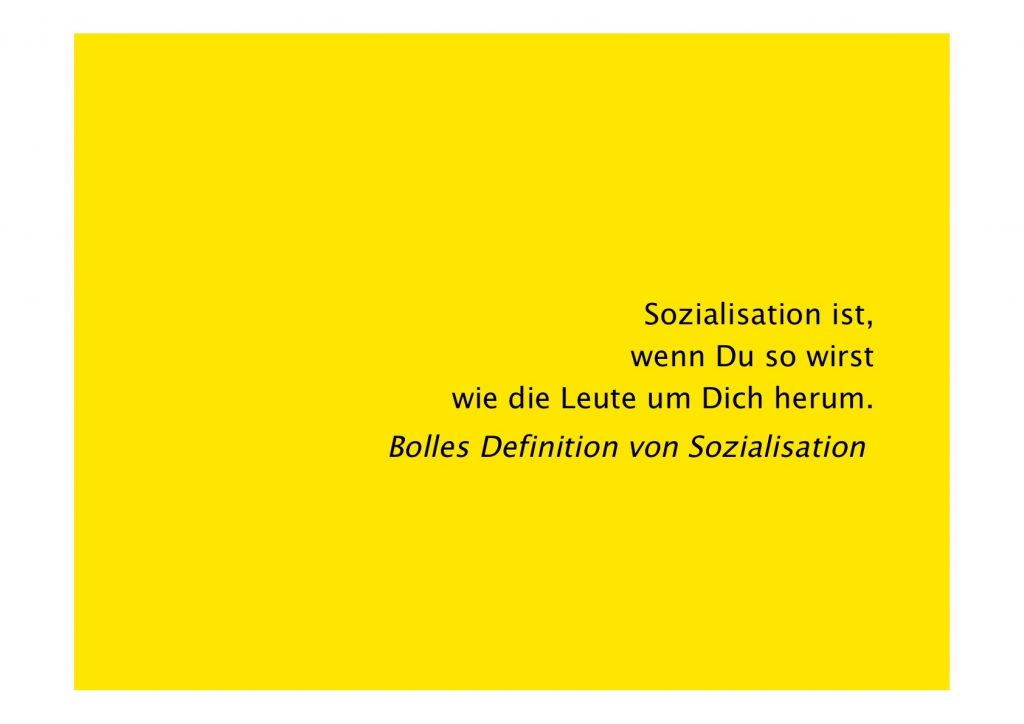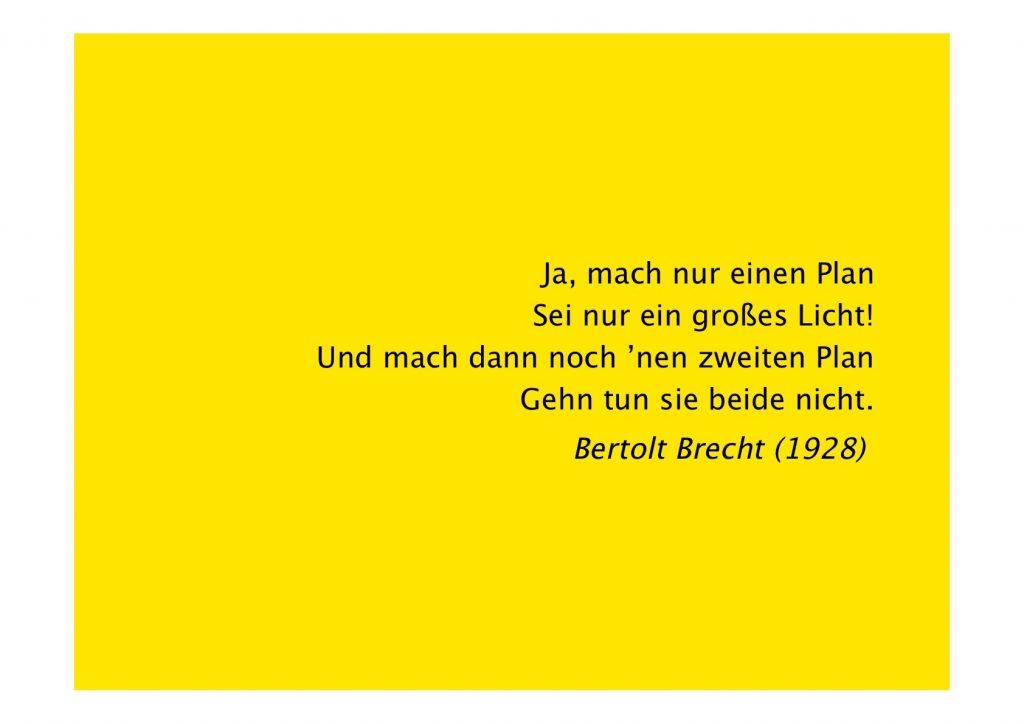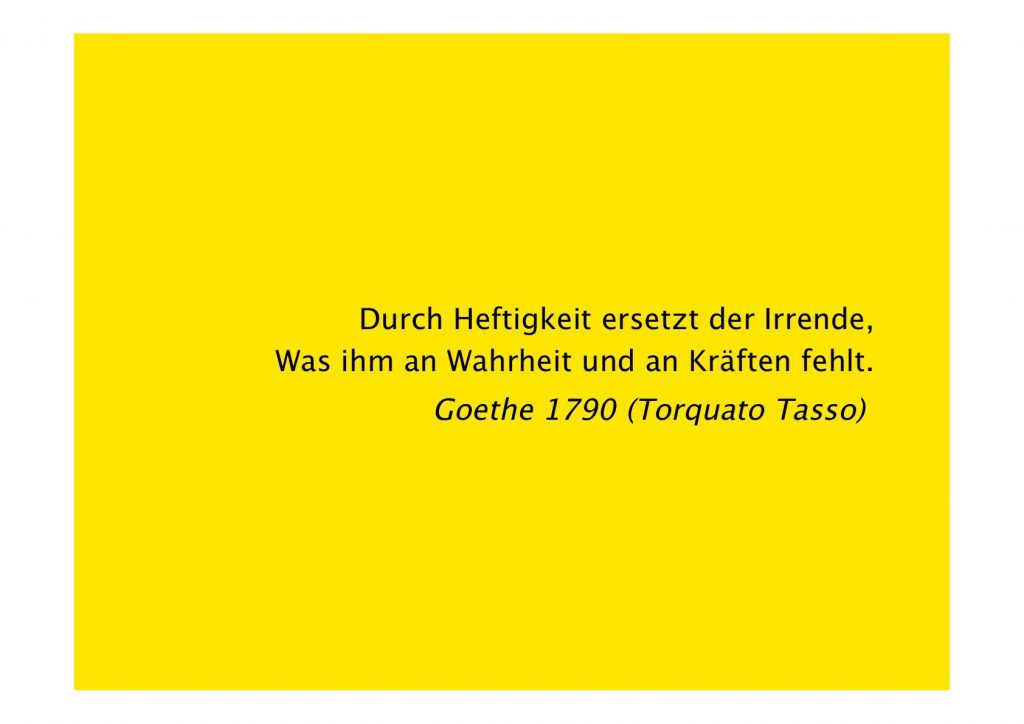
Wenn das stimmt, dann wird’s jetzt heftig. Schließlich steuern wir auf ein sogenanntes „Superwahljahr“ zu mit einer Bundestagswahl plus nicht weniger als sechs Landtagswahlen. Neulich (Do 04-02-21 Höret auf den Herrn …) hatte Bolle deren Zahl noch auf nur fünf geschätzt. Aber erstens neigt er nicht zur Übertreibung, und zweitens kommt es darauf auch nicht wirklich an. Eines der Probleme einer Demokratie ist ja bekanntlich, daß es für einen Politiker (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) nicht nur darauf ankommt, das richtige zu tun – was übrigens unmittelbar die Frage aufwirft, was das denn sein mag, das richtige. Nein, er muß auch noch das Wahlvolk überzeugen, daß das richtige auch wirklich das richtige ist. Selbst wenn es ihm „an Wahrheit und an Kräften“ nicht gebricht, kann er durchaus doch an mangelnder Einsicht des Volkes in die Wahrheit scheitern. Das kann zum Beispiel einen Anton Hofreiter und sein „Häuschen im Grünen“ treffen – weil er diesen Lebensstil, aus trivial-guten Gründen übrigens, für klimaschädlich hält. Menschen an sich sind bekanntlich klimaschädlich. Oder zum Beispiel auch den Gesundheitsminister, der sich mit sich selbst bislang nicht hat einigen können, ob er nun zu viel oder zu wenig Impfstoff hat – bzw. „Impfstoff, den keiner will“. Oder es kann den Berliner Senat mit seiner Mietpreisbremse treffen, die nach Ansicht einiger nur dazu geführt habe, daß es erstens weniger und zweitens nur teureren Wohnraum gebe. Ist das jetzt wahr? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, daß seinerzeit bei der Einführung des Mindestlohnes recht ähnlich argumentiert wurde.
Wir hatten das Thema neulich schon mal gestreift und dabei festgehalten: „Die Malaria wurde in erster Linie durch das Trockenlegen der Sümpfe zurückgedrängt – und nicht etwa durch Chinin. Ganz ähnlich verhält es sich mit ökonomischen Ungleichgewichten. Wenn es nicht gelingt, die Probleme an der Wurzel zu packen, dann wird sich für jedes einzelne Problem, das wir erfolgreich lösen, ein ganz ähnlich gelagertes Problem an irgendeiner anderen Stelle einstellen. Darum ist es so wichtig, auf das gesamtwirtschaftliche Klima zu achten.“ (James Tobin 1965, vgl. dazu Di 02-02-21 Von Gänseblümchen und Brennesseln).
Wie wir leicht erkennen können: Die Probleme ähneln sich – um nicht zu sagen, es sind immer die gleichen. Und? Wer ist schuld? Die Demokraten? Ihre Wähler? Hier schweigt des Sängers Höflichkeit. Im übrigen wäre das dann auch schon wieder ein anderes Kapitel.