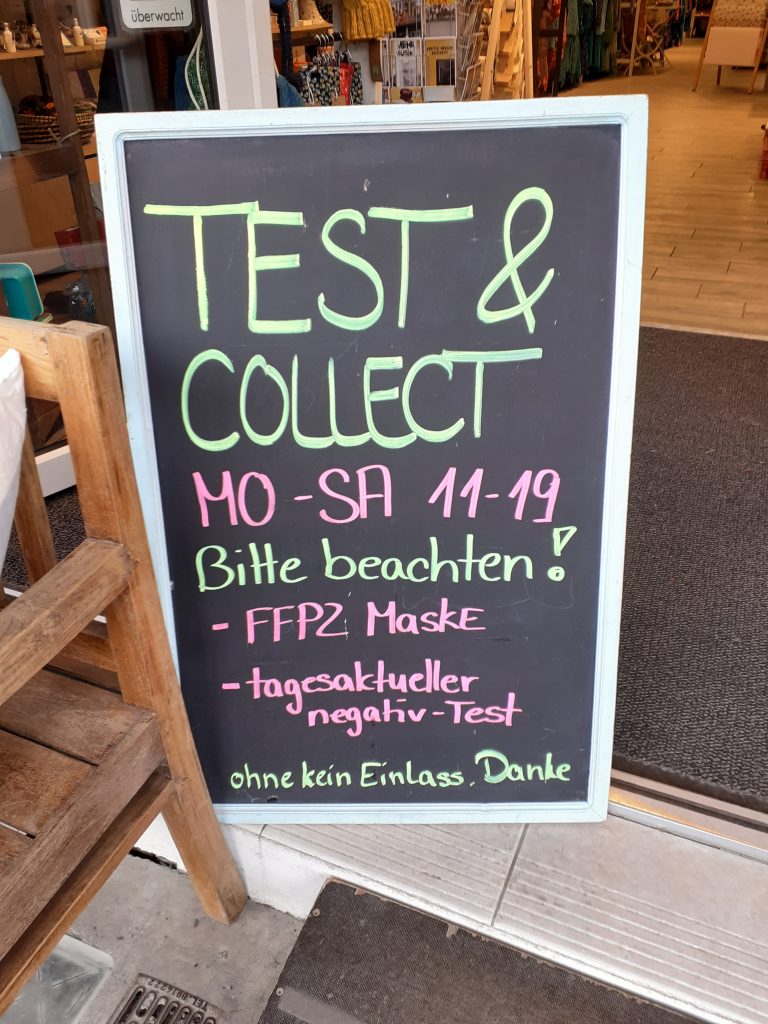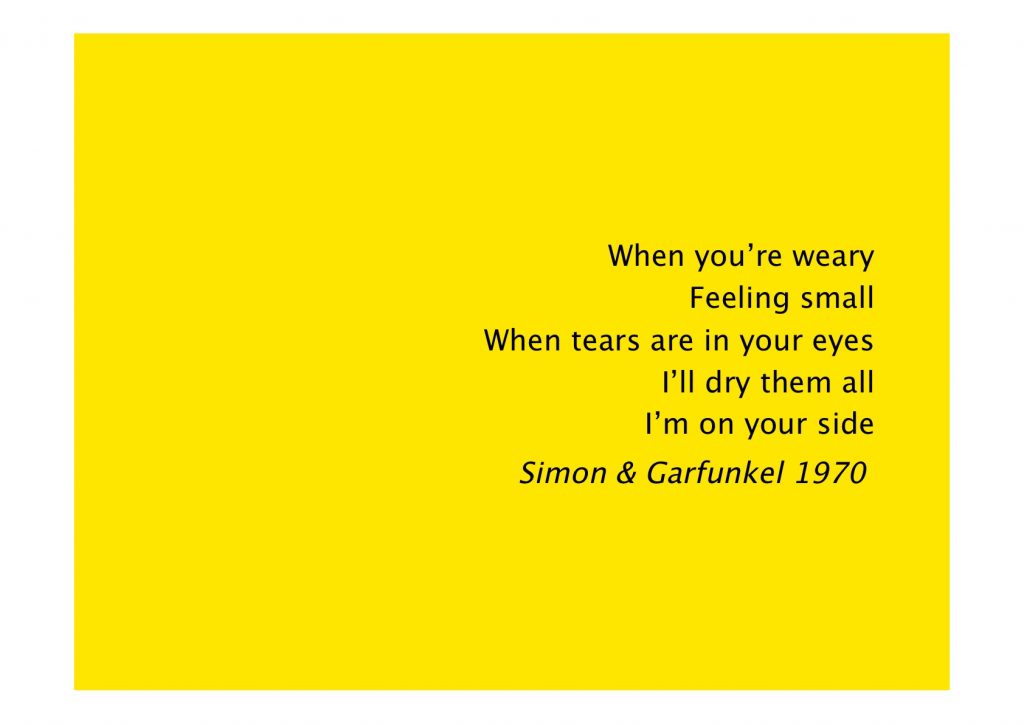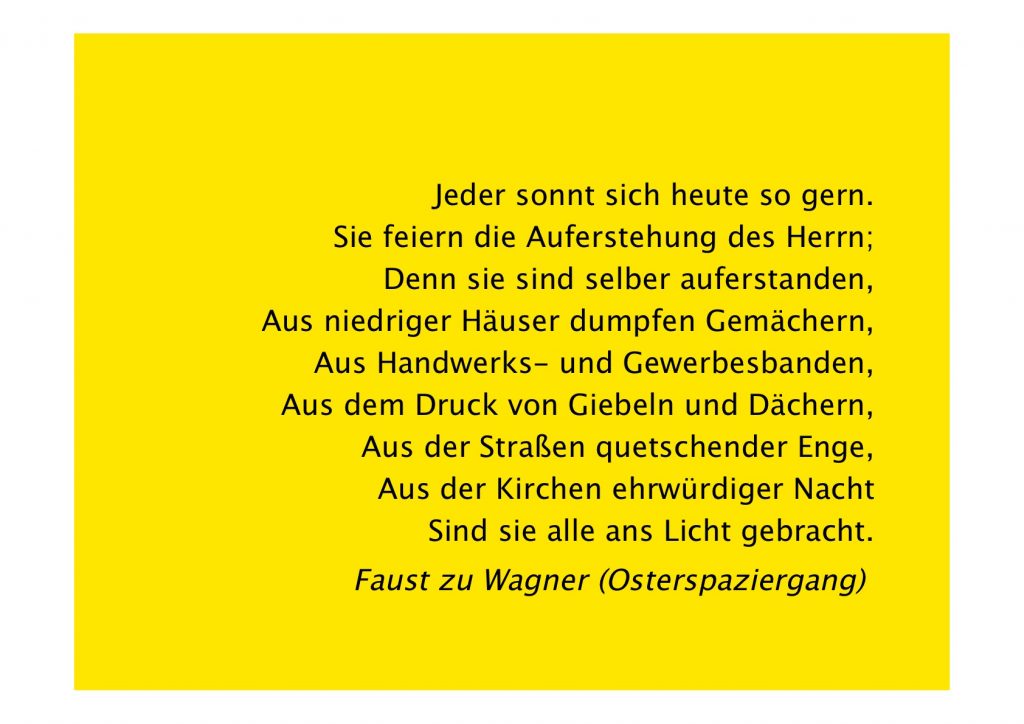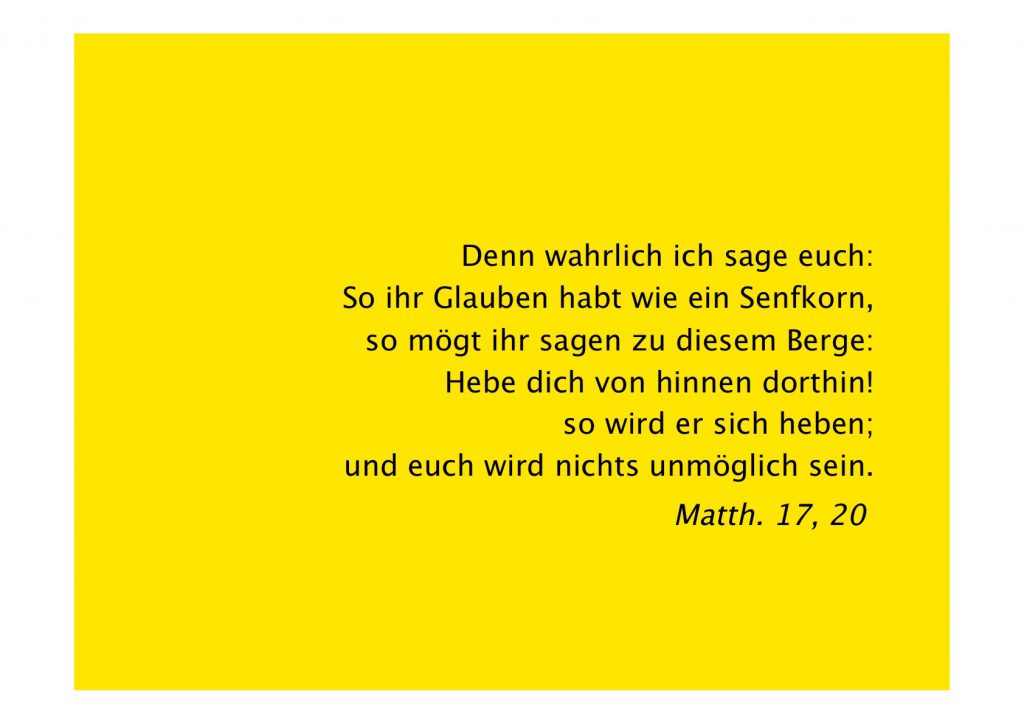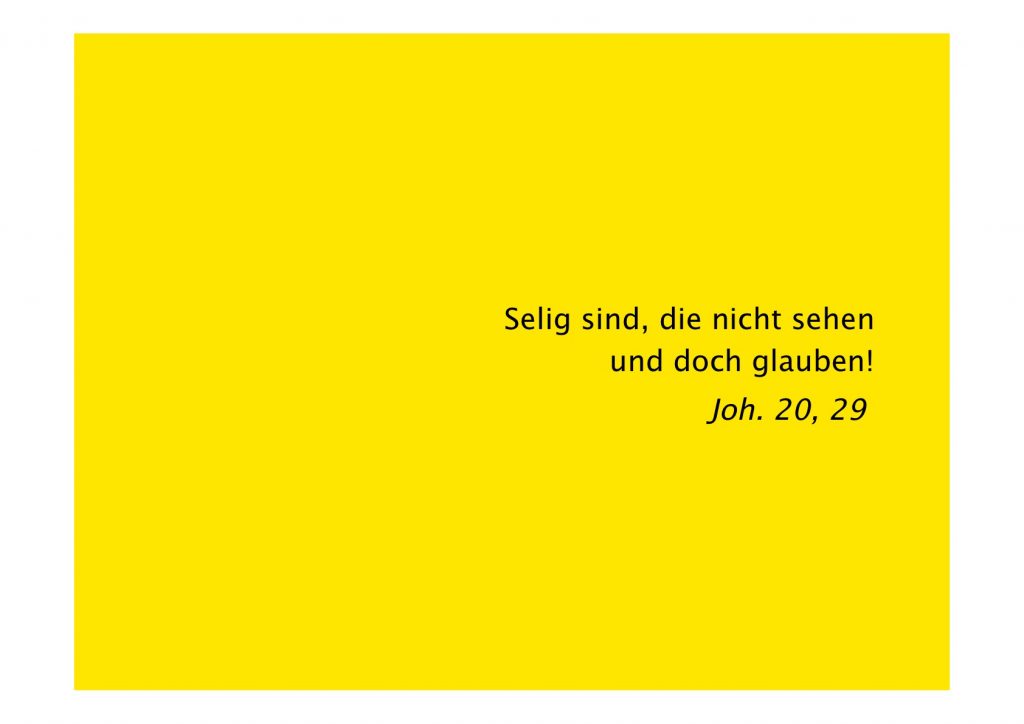Das Dörfchen präsentiert sich in seinem schönsten Gewande. Da möchte man doch gerne raus und, wenn schon nicht unter Linden, so doch zumindest unterm Kirschbaum weilen. Und wieder einmal ist es Faust, der des Volkes Frühlingsgefühl auf den Punkt bringt:
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!
Daß dabei so mancher (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) eher an die Werbebotschaft seines Drogeriemarktes denken wird, soll uns hier nicht weiter bekümmern. Aber möglichst nicht mehr raus zu sollen – jedenfalls nicht aus so trivialen Gründen wie jauchzen oder einfach Mensch zu sein und dabei auch noch zu meinen, das müsse man ja dürfen dürfen – das muß dann doch bedenklich stimmen.
Was bei dem ganzen Corönchen-Gedröhnchen verloren zu gehen droht, ist nicht weniger als der gute alte common sense – hier also etwas so elementares wie der Unterschied zwischen drinnen und draußen. Ein Unterschied also, der durchaus einen Unterschied macht. Werfen wir also einen Blick auf das Grundsätzliche.
Die Lunge, das ist ihre Aufgabe, tauscht sich so richtig fleißig aus mit der Umwelt. Wir atmen ein, wir atmen aus, wir atmen wieder ein … Auf diese Weise kommen wir auf in etwa einen halben Kubikmeter Luftaustausch pro Stunde. Hinzu kommt, daß wir nicht nur Luft austauschen, sondern eben auch Feuchtigkeit – neudeutsch: Aerosole. Das weiß jeder, der schon mal einen Spiegel angehaucht hat. Im Freien verteilt sich das. In geschlossenen Räumen eher nicht. Der eine (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) atmet ein, was der andere vorher ausgeatmet hat. Der Punkt ist: Wir sind an diesen Austausch gewöhnt! Das kann nicht anders sein. Das muß geradezu so sein. Wären wir es nicht, wären wir längst ausgestorben bzw. hätten uns gar nicht erst entwickeln können und die Welt würde den Viren gehören. Tut sie aber nicht.
Stellen wir spaßeshalber eine kleine Extremfall-Betrachtung an und nehmen wir an, jemand atme ein einziges vereinzeltes Corönchen ein. Ist der jetzt „infiziert“? Corönchen-Positiv? Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Plausibler ist, das dieses eine einzige Corönchen vom Immunsystem so auf die Mütze kriegt, daß ihm Hören und Sehen vergeht.
Wie verhält es sich bei 2, 3, oder 10 Corönchen? Wahrscheinlich ändert sich nicht viel. Wie ist es bei 100? Bei 1.000 gar? Irgendwann wird vermutlich ein Punkt erreicht sein, wo sich das Immunsystem überrumpelt fühlt und dann doch ein wenig schwächelt. Wer sich also an einem einzigen Abend und auf einen Schlag die volle Ischgl-Dröhnung gibt, muß sich nicht weiter wundern, wenn er sich schlimmerenfalls auf einer Intensivstation wiederfindet.
Bei einer feinverteilten Aufnahme könnte das ganze allerdings ganz anders aussehen: Das Immunsystem kommt mit den Corönchen nicht nur klar – es „lernt“ auch, daß da was im Anmarsch ist. Der Effekt könnte der gleiche sein wie bei einer herkömmlichen Impfung. Eine abgeschwächte Viruslast bereitet das Immunsystem auf höhere Viruslasten vor. Bio Protection, sozusagen – ganz natürlich und völlig ohne Pieks.
Umgekehrt bedeutet das: Wenn einer empfehlungskonform peinlichst darauf achtet, mit Corönchen gar nicht erst in Kontakt zu kommen, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit ernorm, daß bei erstbester Gelegenheit die volle Ischgl-Packung auf sein völlig unvorbereitetes Immunsystem trifft – und zwar mit allen unerfreulichen Konsequenzen. „Je zivilisierter, desto sterilisierter“ – die Schlafschul-Weisheit aus Huxley’s ›Schöne Neuer Welt‹ (1932), vgl. dazu Sa 23-01-21 In vino veritas – ist nach allem wohl bei weitem nicht der Weisheit letzter Schluß. Was dann? „Die Welt wohldosiert berühren“, nennt das der alte Indianer. Wohl dosiert. Berühren. Also nicht mitten reinplatschen – und auch nicht schreiend davonlaufen oder sich unterm Sofa verkriechen (duck and cover). Aber vielleicht ist das einfach viel zu einfach, um einzuleuchten.
Ob das alles so stimmt, kann Bolle natürlich auch nicht sagen. Nur einleuchten würde es ihm halt. Bevor es jemand ausprobieren mag, sollte er vielleicht doch besser zunächst seinen Arzt oder Apotheker fragen. Vielleicht weiß der ja mehr. Aber das ist dann doch schon wieder ein anderes Kapitel.