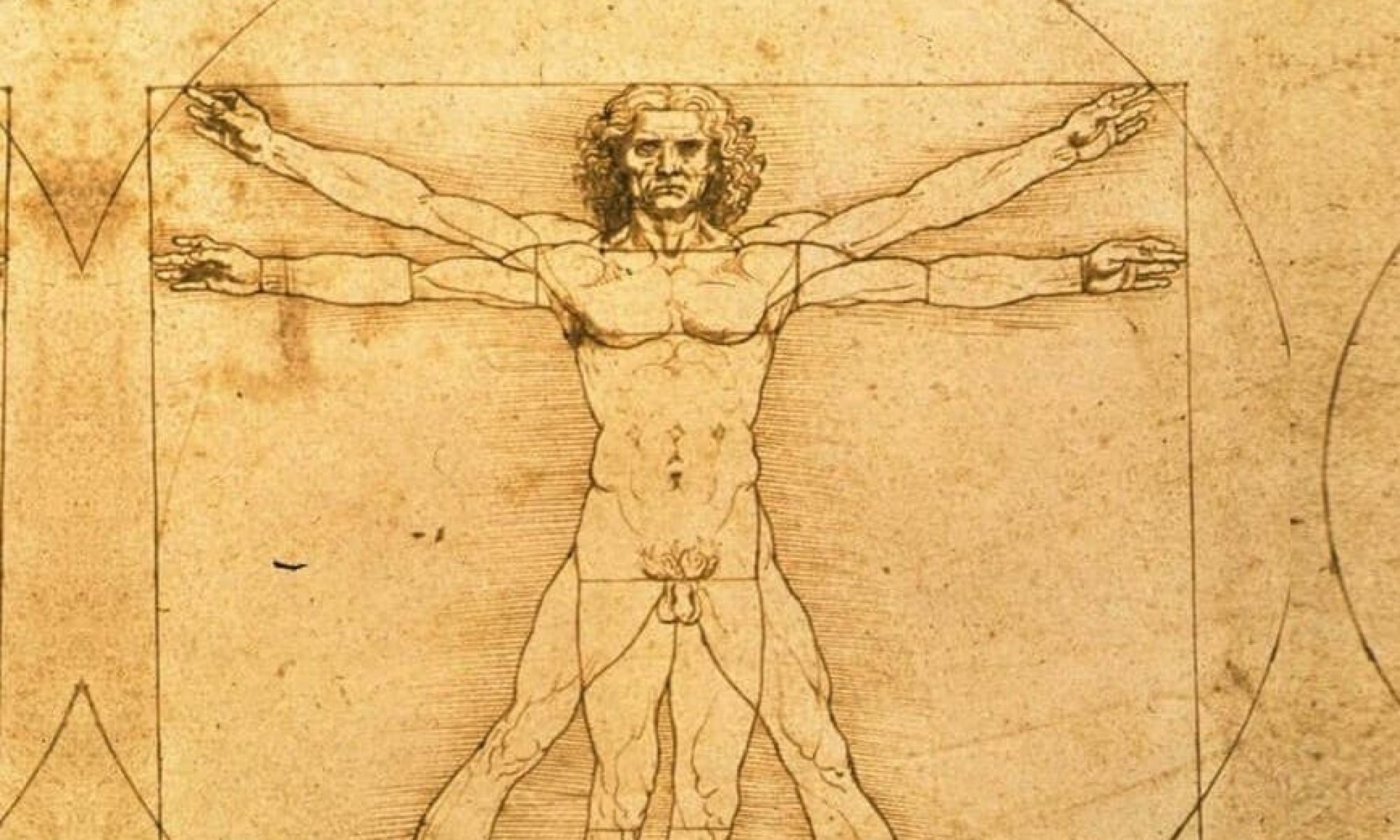Neulich lief ›Let It Be‹ in Mutters Radio – ein alter Beatles-Song von 1970. Da werden natürlich Erinnerungen wach, of course. Neben dem Lied an sich mußte Bolle daran denken, wie seinerzeit ein vielleicht doch ein wenig klugscheißerischer Radiomoderator meinte zum Besten geben zu müssen, daß er sich nicht sicher sei, ob das wirklich „words of wisdom“ seien, die da gewispert wurden – wie es im Text heißt.
Nun, die Antwort hängt natürlich nicht zuletzt schwer davon ab, ob man unter ›let it be‹ ein abgeklärtes ›So-sein-lassen‹ verstehen will oder ein eher resignatives ›Bleibenlassen‹ im Sinne von widerspruchs- und tatenlos hinnehmen. Im Grunde verhält es sich wie mit dem ›Gelassenheitsgebet‹ in Bolles agnostisch-kontemplativer Fassung (vgl. dazu Fr 23-12-22 Das dreiundzwanzigste Türchen …).
Wenn Du etwas ändern kannst auf der Welt −
dann sei tüchtig in dem, was Du tust.
Wenn Du aber etwas nicht ändern kannst,
dann mach Dir klar: Shit happens −
und verliere darüber nicht Dein Gleichgewicht.
Zuweilen braucht es großen Seelenfrieden,
die beiden Fälle zu unterscheiden.
In ganz jungen Jahren war es in Bolles Kreisen üblich, der Mama zum Muttertag ein Bild zu malen. Große Kunst wird das kaum gewesen sein. Allein es kam von Herzen – und die Mütter dieser Welt haben viele dieser Werke getreulich aufbewahrt.
Mit zunehmender Adoleszenz setzte dann oft ein gewisses Abgrenzungsbedürfnis ein: Man versucht herauszufinden, wer man selber ist, was man gutfindet und was nicht. Dabei ist das, was man selber gutzufinden meint, selten das, was auch die Eltern – namentlich die Frau Mama – gutfinden. Oft genug im Gegenteil. Das muß natürlich zu gewissen Spannungen führen. Jedenfalls werden keine Bilder mehr gemalt – und auch ersatzweise passiert oft recht wenig.
Immerhin darf Bolle sich zugutehalten, daß er nie so doof war, irgendwelchen Ideologen auf den Leim zu gehen, die zum Beispiel meinten, der Muttertag sei ja wohl eine Nazi-Erfindung und schon von daher abzulehnen. Im Gegenteil: Bolle kann sich noch lebhaft an eine Sternstunde seines Sozialkundeunterrichtes in der Oberstufe erinnern, als sein Studienrat, ein alter 68er immerhin, meinte: „Die haben pubertäre Probleme und machen ein politisches Konzept daraus.“ Bolle – damals wohl im Kern schon agnostisch-kontemplativ – war entzückt.
Die originär-adoleszente Abgrenzung funktioniert ja in etwa wie folgt: Ein Jüngling (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) verfährt nach dem Motto ›I am o.k.‹ – das muß wohl so sein als gesunde pubertäre Grundeinstellung – und weiterhin ›Du bist folglich not o.k.‹, wenn Du nicht meiner Meinung bist oder meine Werte (im Sinne von ›allgemeines Für-richtig-halten‹) nicht teilen willst. Damit aber lehnt er alles ab, was er als vorgesetzt oder gar als aufgesetzt empfindet. Mit der Ablehnung ist regelmäßig eine entsprechende Abwertung verbunden, of course. Schließlich steht man ja noch ziemlich am Anfang der Menschwerdung. Und wer oder was würde sich hier besser als Projektionsfläche eignen als die eigene Mama?
Fortgeschrittenere Adoleszenz – man könnte auch sagen: Altersmilde – dagegen besteht wohl darin, daß man andere, also nicht zuletzt die eigene Frau Mama, in ihrem So-Sein so lassen kann, wie sie nun mal ist – ohne nervig-penetrant stets Wahrheit für andere meinen haben zu müssen. Letztlich ist das wohl weniger eine Frage der Überzeugung als vielmehr eine Frage der Haltung. Ohne ein gewisses Maß an Haltung aber windet man sich wohl im Wesentlichen als Würmchen durch das Weltgeschehen. Und wer will das schon – bei Lichte betrachtet?
Paul McCartney übrigens meinte zur Entstehungsgeschichte seines ›Let It Be‹, mit ›Mother Mary‹ sei in der Tat seine eigene Frau Mama gemeint gewesen, die ihm in rauhen Zeiten – die Beatles waren seinerzeit in Auflösung begriffen – im Traum erschienen sei. Dabei fügte er hinzu: „Sie starb, als ich 14 war. Folglich hatte ich ziemlich lange wenig von ihr gehört.“ Bolle findet, hier wie auch sonst so oft: Gebraucht der Zeit – sie eilt so schnell von hinnen. Später ist es oft zu spät – und führt dann regelmäßig zu den üblichen langen Gesichtern. Nicht nur, was den Muttertag angeht. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.